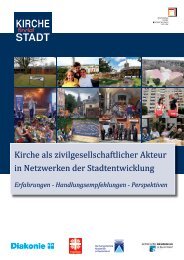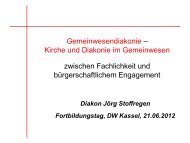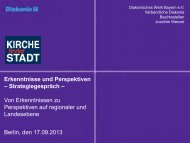Kirche mitten drin« Sozialer, struktureller und ... - Kirche findet Stadt
Kirche mitten drin« Sozialer, struktureller und ... - Kirche findet Stadt
Kirche mitten drin« Sozialer, struktureller und ... - Kirche findet Stadt
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
14 10/2013 epd-Dokumentation<br />
»Exklusion«. Mit diesem Begriff soll zum einen<br />
angedeutet werden, dass die Benachteiligten nicht<br />
nur relativ schlechter gestellt sind, als Wohlhabende,<br />
sondern dass sie aus relevanten sozialen Beziehungen<br />
<strong>und</strong> Aktivitäten, vor allem aus den in<br />
modernen Gesellschaften zentralen Marktvorgängen<br />
ausgeschlossen sind. Aber auch aus der Politik<br />
sind diese Gruppen zunehmend ausgegrenzt. Weder<br />
ökonomisch noch politisch sind diese Menschen<br />
erforderlich, sie werden tendenziell überflüssig.<br />
Da sie auch keine relevante Mehrheit bilden<br />
– ihr Anteil an der Bevölkerung pendelt sich<br />
auf Werte um acht bis zehn Prozent ein – sind sie<br />
auch für die Politik nicht entscheidend, werden<br />
daher immer weniger berücksichtigt. In einer<br />
Kommunalpolitik, die zunehmend auf Imageelemente<br />
als Standortfaktoren setzt, passen diese<br />
benachteiligten Gruppen nicht mehr »ins Bild«, so<br />
dass sie in der Erscheinung der <strong>Stadt</strong>, wie sie in<br />
den Medien oder der Städtewerbung präsentiert<br />
wird, nicht mehr vorkommen. In einer Mediengesellschaft<br />
aber verschwindet das, was nicht in den<br />
Medien erscheint, irgendwann tatsächlich aus dem<br />
öffentlichen Bewusstsein, auch wenn es noch existiert.<br />
In der Frühindustrialisierung scheint das ganz<br />
ähnlich gewesen zu sein. Auch im frühen <strong>und</strong><br />
mittleren 19. Jahrh<strong>und</strong>ert wusste das »Bürgertum«<br />
nicht, dass es ein elendes Proletariat überhaupt<br />
gab. Das änderte sich gr<strong>und</strong>legend erst im<br />
20.Jarhh<strong>und</strong>ert, in dem die Arbeiterschaft als die<br />
traditionell benachteiligte Bevölkerungsgruppe<br />
durch sozialistische Parteien <strong>und</strong> Gewerkschaften<br />
ein hohes Maß an öffentlicher Aufmerksamkeit<br />
erreichte.<br />
Die neuen Ausgegrenzten scheinen sich wieder<br />
auf dem Weg zur Unsichtbarkeit, zur Nicht-<br />
Existenz in der öffentlichen Aufmerksamkeit zu<br />
befinden. Die Arbeiterschaft galt zumindest ab<br />
den 1960er- <strong>und</strong> 1970er-Jahren als integriert. Sie<br />
verlor damit ihren Klassencharakter, da der Begriff<br />
der »Klasse« immer die umfassende Entgegensetzung<br />
zu einer anderen, eben der »bürgerlichen<br />
Klasse«, signalisieren sollte. Die neuen Benachteiligten<br />
könnten zu einer neuen »städtischen<br />
Unterklasse«, zur »new urban <strong>und</strong>erclass« werden,<br />
ausgegrenzt aus allen relevanten sozialen<br />
Aktivitäten. Extrem hohe Arbeitslosigkeitszahlen,<br />
wie sie in manchen <strong>Stadt</strong>teilen <strong>und</strong> Regionen der<br />
neuen B<strong>und</strong>esländer anzutreffen sind, stellen<br />
einen sicheren Hinweis auf Entstehung einer solchen<br />
»Unterklasse« dar.<br />
4. Polarisierung von »Schrumpfung« <strong>und</strong> »Wachstum«<br />
Bereits in den 1980er-Jahren zeigte sich in der<br />
alten B<strong>und</strong>esrepublik eine neue Entwicklung von<br />
Gegensätzen im so genannten »Süd-Nordgefälle«.<br />
Die nördlichen B<strong>und</strong>esländer, vor allem diejenigen<br />
mit altindustriellen Regionen, zeigten<br />
Schrumpfungstendenzen durch Abwanderung<br />
von Arbeitsplätzen <strong>und</strong> Einwohnern, während die<br />
Dienstleistungszentren des Westens <strong>und</strong> Südens<br />
deutliche Wachstumsgewinne verbuchen konnten.<br />
Gleichzeitig sanken oder stagnierten die<br />
Durchschnittseinkommen in den Schrumpfungsgebieten,<br />
während sie im Süden stiegen. Vor allem<br />
die Arbeitslosigkeitszahlen waren in den<br />
nördlichen Regionen deutlich höher als im Westen<br />
<strong>und</strong> Süden, vermutlich der Hauptgr<strong>und</strong> für<br />
die Wanderungsbewegungen von Nord nach Süd.<br />
Seit der deutschen Vereinigung wird dieses Süd-<br />
Nord-Gefälle von einem West-Ost-Gefälle überlagert,<br />
das gleichfalls, nur in sehr viel stärkerem<br />
Maße Wanderungsbewegungen von Ost, den<br />
neuen B<strong>und</strong>esländern, nach West, den alten<br />
B<strong>und</strong>esländern auslöst. Diese Wanderungen haben<br />
dazu geführt, dass die Dienstleistungsmetropolen<br />
des Westens, vor allem Hamburg <strong>und</strong> Hannover<br />
im Norden, Frankfurt, die Rheinschiene<br />
Düsseldorf – Köln, der Stuttgarter Raum <strong>und</strong><br />
München ihre Einwohnerzahlen trotz b<strong>und</strong>esweit<br />
rückläufiger Einwohnerzahlen nicht nur stabilisieren<br />
sondern z. T. deutlich erhöhen konnten,<br />
während vor allem Regionen im Nordosten, also<br />
im Norden der neuen B<strong>und</strong>esländer, in dramatischer<br />
Weise Einwohner verlieren. Die größten<br />
Verluste weisen Mecklenburg-Vorpommern <strong>und</strong><br />
die östlichen Teile Sachsens auf, aber mit Ausnahme<br />
Berlins <strong>und</strong> seines Umlandes haben alle<br />
ostdeutschen Regionen Bevölkerungsverluste<br />
durch Abwanderung erheblichen Ausmaßes hinzunehmen<br />
(Hänsgen u. a. 2010:24). Anhaltende<br />
Abwanderung von ein bis zwei Prozent pro Jahr<br />
scheint keine Ausnahme mehr zu sein, <strong>und</strong> es<br />
wird davon ausgegangen, dass sie sich in den<br />
kommenden Jahren in den bisher schon betroffenen<br />
Teilräumen fortsetzt.<br />
Bedrohlich werden diese Abwanderungen aber<br />
vor allem, weil sie selektiv verlaufen. Es wandern<br />
vorwiegend die gut qualifizierten Jüngeren <strong>und</strong><br />
hier wiederum besonders die Frauen ab, so dass<br />
in den schwachen Räumen deutliche Männerüberschüsse<br />
vor allem bei den jüngeren Jahrgängen<br />
entstehen (Hänsgen u. a. 2010:23). Gute Berufsperspektiven<br />
liegen für gut qualifizierte junge<br />
Frauen vor allem in den modernen Dienstleistun-