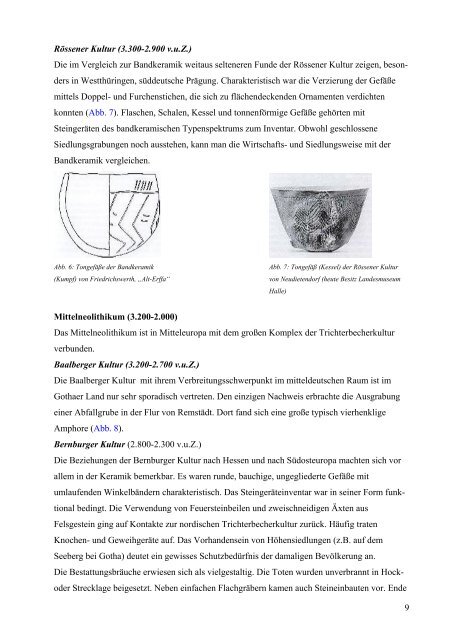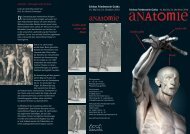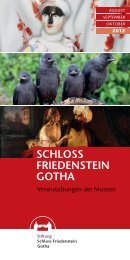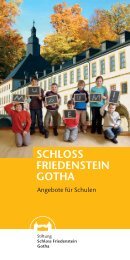1 Thomas Huck Die ur- und frühgeschichtliche Besiedlung (100.000 ...
1 Thomas Huck Die ur- und frühgeschichtliche Besiedlung (100.000 ...
1 Thomas Huck Die ur- und frühgeschichtliche Besiedlung (100.000 ...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Rössener Kult<strong>ur</strong> (3.300-2.900 v.u.Z.)<br />
<strong>Die</strong> im Vergleich z<strong>ur</strong> Bandkeramik weitaus selteneren F<strong>und</strong>e der Rössener Kult<strong>ur</strong> zeigen, beson-<br />
ders in Westthüringen, süddeutsche Prägung. Charakteristisch war die Verzierung der Gefäße<br />
mittels Doppel- <strong>und</strong> F<strong>ur</strong>chenstichen, die sich zu flächendeckenden Ornamenten verdichten<br />
konnten (Abb. 7). Flaschen, Schalen, Kessel <strong>und</strong> tonnenförmige Gefäße gehörten mit<br />
Steingeräten des bandkeramischen Typenspektrums zum Inventar. Obwohl geschlossene<br />
Siedlungsgrabungen noch ausstehen, kann man die Wirtschafts- <strong>und</strong> Siedlungsweise mit der<br />
Bandkeramik vergleichen.<br />
Abb. 6: Tongefäße der Bandkeramik Abb. 7: Tongefäß (Kessel) der Rössener Kult<strong>ur</strong><br />
(Kumpf) von Friedrichswerth, „Alt-Erffa“ von Neudietendorf (heute Besitz Landesmuseum<br />
Halle)<br />
Mittelneolithikum (3.200-2.000)<br />
Das Mittelneolithikum ist in Mittele<strong>ur</strong>opa mit dem großen Komplex der Trichterbecherkult<strong>ur</strong><br />
verb<strong>und</strong>en.<br />
Baalberger Kult<strong>ur</strong> (3.200-2.700 v.u.Z.)<br />
<strong>Die</strong> Baalberger Kult<strong>ur</strong> mit ihrem Verbreitungsschwerpunkt im mitteldeutschen Raum ist im<br />
Gothaer Land n<strong>ur</strong> sehr sporadisch vertreten. Den einzigen Nachweis erbrachte die Ausgrabung<br />
einer Abfallgrube in der Fl<strong>ur</strong> von Remstädt. Dort fand sich eine große typisch vierhenklige<br />
Amphore (Abb. 8).<br />
Bernb<strong>ur</strong>ger Kult<strong>ur</strong> (2.800-2.300 v.u.Z.)<br />
<strong>Die</strong> Beziehungen der Bernb<strong>ur</strong>ger Kult<strong>ur</strong> nach Hessen <strong>und</strong> nach Südoste<strong>ur</strong>opa machten sich vor<br />
allem in der Keramik bemerkbar. Es waren r<strong>und</strong>e, bauchige, ungegliederte Gefäße mit<br />
umlaufenden Winkelbändern charakteristisch. Das Steingeräteinventar war in seiner Form funk-<br />
tional bedingt. <strong>Die</strong> Verwendung von Feuersteinbeilen <strong>und</strong> zweischneidigen Äxten aus<br />
Felsgestein ging auf Kontakte z<strong>ur</strong> nordischen Trichterbecherkult<strong>ur</strong> z<strong>ur</strong>ück. Häufig traten<br />
Knochen- <strong>und</strong> Geweihgeräte auf. Das Vorhandensein von Höhensiedlungen (z.B. auf dem<br />
Seeberg bei Gotha) deutet ein gewisses Schutzbedürfnis der damaligen Bevölkerung an.<br />
<strong>Die</strong> Bestattungsbräuche erwiesen sich als vielgestaltig. <strong>Die</strong> Toten w<strong>ur</strong>den unverbrannt in Hock-<br />
oder Strecklage beigesetzt. Neben einfachen Flachgräbern kamen auch Steineinbauten vor. Ende<br />
9