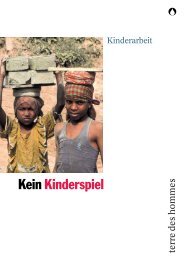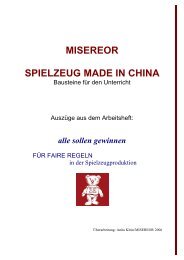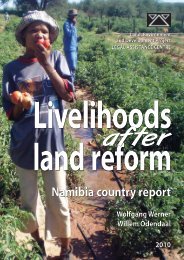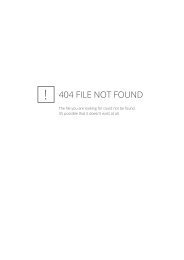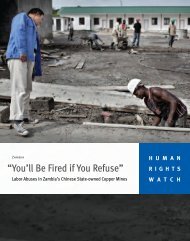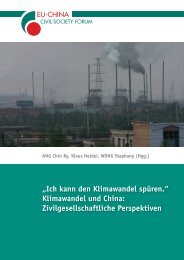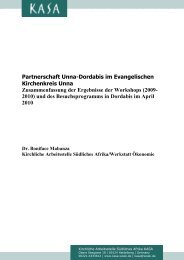fährdung. Die Strategie der Hilfswerke,Interessenskonflikte mit zivilen Mittelnangehen, den offenen Dialog führenund gewaltfreie Lösungen suchen zuhelfen, würde durch ihren eigenenSchutz und ihre eigene Identifizierungmit bewaffnetem Militär in einer Sackgasseenden. Zumal dies außerdemnoch eher den Konflikt anheizen, alsdie Gemüter zu friedlichen Austauschund versöhnlichen Lösungen bewegenwürde.Vom militärischen Schutz zur politischenEinbindungSolchen Bedenken wird häufig mit demArgument entgegengetreten, dass dieneuen Bedrohungsszenarien auch neuepolitische Antworten und Sicherheitsstrategienverlangen – die in der Logiknicht nur die militärische Sicherungziviler humanitärer Hilfe und zivilenWiederaufbaus, sondern auch derenpolitische Einbindung und direkte Kooperationmit dem Militär in Konfliktregionennotwendig machen. Und inder Tat drängen NATO, EU und dienationalen Regierungen schon länger indiese Richtung.Im deutschen Falle unternahmen Regierungsstellen4 schon 1997 Anstrengungen,bei der Flüchtlingsrückführung inBosnien-Herzegowina humanitäre Organisationenzu enger Zusammenarbeitmit der Bundeswehr zu bringen. Nachder „humanitären“ Nato-Intervention1999 im Kosovo hatte die Bundeswehrschon feste zivil-militärische Einheiten(CIMIC), die zivile Organisationen ingemeinsame Hilfs- und Wiederaufbauprojekteeinzubinden suchten.2000/2001 unternahm das AuswärtigeAmt erhebliche Anstrengungen, diehumanitären Hilfsorganisationen fürformale Leitlinien zur Zusammenarbeitund Koordination mit der Bundeswehrzu gewinnen. Ende 2003 waren es die4 Bundesministerium des Inneren, Bundesministeriumfür wirtschaftliche Zusammenarbeitgenannten zivil-militärischen Aufbauteams(PRT) in Afghanistan, die nachdem politischen Konzept der Bundesregierungin solchen ‚Sicherheitsinseln’auch zivile Organisationen für einengemeinsamen sozialen, wirtschaftlichenund politischen Wiederaufbau einbindensollen.Allerdings macht Wehklagen über die,Instrumentalisierung’ durch Politik undMilitär wenig Sinn. Zivile Organisationensind keine hilflosen Objektevon Entwicklungen, sondern Akteure,die bewusst in einem politischen Umfeldwirken, sich damit auseinandersetzenund ihren Weg finden müssen. Dieentscheidende Frage ist, ob sie dasBoot dieser neuen Sicherheitspolitik fürtragfähig und stabil halten. Kann mandarauf vertrauen, dass es nachhaltigund möglichst umfassend menschlicheSicherheit in dieser unsicheren Weltbringt oder nicht? Sollte das Boot zuviele Schwachstellen, Lecks und gar zugeringe Aufnahmekapazität haben,wäre Werbung für das Boot und erstrecht die Mitfahrt höchst gefährlichund man müsste verantwortlicherweiseauf Distanz gehen, seine Grundüberholungoder Neubau fordern.Globale menschliche Sicherheit –mehr als Sicherheitspolitik für denNordenWo die Politik vor 15 Jahren noch eineleuchtende Zukunft allgemeinen Wohlstands,Demokratie und Friedens prognostizierte,herrscht inzwischen großeErnüchterung und zunehmender Konsens,dass das Ende des Kalten Kriegesund die vom Westen forcierte ökonomischeGlobalisierung die heutige weltweiteUnsicherheit mitverursacht haben.Selbst in den Analysen über die ‚Brutstätten’des Terrors oder der Forderungnach einer ‚mitfühlenden’ Globalisierungschimmert diese Erkenntnis durch.Diese Entwicklung hat die wirtschaftlicheVerarmung, den sozialen und politischenZerfall großer Regionen der ehemalsDritten und Zweiten Welt – geradebei heterogenen oder künstlichen Staatenaus der Kolonialzeit – immens verstärkt.Die Folgen:– Blutige Bürgerkriege um politischeMacht und Verteilung der knappenRessourcen, zum Teil entlang ethnischerund religiöser Grenzen;– Verlust sozialer Mindestsicherheitenfür ganze Bevölkerungen, so dassjeder Notfall zur existenziellenKatastrophe und eine ansteckendeKrankheit zur tödlichen Epidemiewerden kann;– Schattenglobalisierung mit einerBlüte krimineller Wirtschaftszweigewie des Frauen-, Drogen- undWaffenhandels, die vielen ArmenEinkommen versprechen und Leidschaffen;– Massenflucht in den wohlhabenderen,sicheren, aber sich hermetischabschottenden Norden.Es ist kein Wunder, wenn aus diesemNährboden nicht nur Resignation, Untertänigkeitund innere Zerfleischungkommt, sondern auch Ablehnung undHass, Widerstand und Gewalt gegen alldas wächst, was als Verteidiger, Vollstreckerund Nutznießer dieses ‚ungerechten’Systems gesehen wird, bis hinzu der extremen Form eines Terrorismusmit seinen brutalen Anschlägen,der unsere, aber auch die Sicherheit derjeweils eigenen Bevölkerung bedroht.Eine solche Analyse globaler menschlicherUnsicherheit – und die Schlussfolgerung,dass nur gleichberechtigterDialog, wirksame Armutsbekämpfungund Verminderung des wachsendenGefälles zwischen Arm und Reich siewirklich überwinden kann – verträgtsich kaum mit einer Sicherheitspolitik,welche der Verteidigung wirtschaftlicherEigeninteressen, politischerÜberlegenheit und militärischerVorwärtsverteidigung des Nordens denVorzug gibt. Diese Einsicht hat sich beiwichtigen zivilen Hilfswerken durchge-Social Watch Report Deutschland / 45
setzt: „Sicherheit ist unteilbar: WederNord noch Süd noch einzelne Staatenkönnen sie für sich allein gewinnen undbewahren, ohne sie der Mehrheit derBevölkerung und der Völker zuzugestehen.Sie ist umfassend und beinhaltetzwingend auch wirtschaftliche undsoziale Sicherheit als ein wichtiges Gutfür alle Menschen. Sie zu verwirklichenerfordert einen globalen Interessenausgleich,der vom Norden erheblicheZugeständnisse und Veränderungen verlangenwird.“ 5Sicherlich betont die deutsche Sicherheitspolitikneben militärischen Mitteln(hard power), auch die Notwendigkeitpräventiver staatlicher, humanitärerHilfe und Armutsbekämpfung (softpower). Allein, diese bleiben vom politischenGewicht und ihrer Rolle eherein Anhängsel. Angesichts der Riesenproblemesind weder die Mittel fürnachhaltige humanitäre Hilfe und Entwicklungszusammenarbeitim mindestenangemessen, noch wirken bloßeÜberlebenshilfen und marktwirtschaftliche‚Fitnessprogramme’ sozial überzeugend.Wenn außerdem die ohnehingeringen Mittel zum Kampf gegen globaleökonomische und soziale Unsicherheitauch noch die militärischeSicherheit mitfinanzieren sollen, weil –gemäß Forderungen in der EuropäischenUnion und der Organisation fürWirtschaftliche Zusammenarbeit undEntwicklung (OECD) „EntwicklungSicherheit braucht“, führt das vollendszur politischen Unterordnung. Solangedie eigenen Wirtschafts- und SicherheitsinteressenVorrang behalten undihre Vormacht verteidigen, gerät selbstgut gemeinte soft power in Glaubwürdigkeitsproblemeund muss ihre Rollehinterfragen.Militärische Stabilisierung aufMindestniveau – keine Blaupause fürdie ZukunftSchauen wir uns die bisherigen Ergebnissewestlicher beziehungsweise deutscherSicherheitspolitik in Konfliktgebietenan, so sind die Ergebnisse ernüchternd:Nach internationaler Militärintervention,Aufbruchstimmung undAufbaufinanzierung gehören Bosnienund der Kosovo heute zu den wiedervergessenen, aber explosiven ArmenhäusernEuropas. Beide sind künstlicheGebilde geblieben, die letztlich voneiner internationalen Verwaltung mitHilfe von NATO-Militär regiert und mitmöglichst geringem Aufwand auf diesemNiveau ‚stabilisiert’ werden sollen– und selbst dies gelingt kaum, wie diejüngsten Ausschreitungen im Kosovobeweisen. Ein Ende dieser UN-Protektorateund externer militärischen Sicherungist nicht abzusehen. Auch derZweckoptimismus für Afghanistan – fürdie Bundesregierung steht angesichtsihres exponierten Engagements viel aufdem Spiel – kann nicht darüber hinwegtäuschen,dass der Aufbau eineszentralen Nationalstaates in einemLand ohne jegliche wirtschaftlicheBasis und mit traditionell dezentralenMachtsstrukturen und Überlebenswirtschafteine moderne Illusion bleibenkönnte. Diese aufrechtzuerhalten,wird auch hier dauerhafte internationaleMilitärpräsenz, Stützung undMindestfinanzierung eines solchenStaatsgebildes notwendig machen, ihmaber kaum Ruhe und interne demokratischeLegitimation bringen. Der heftigeWiderstand der Provinzherren und derverbliebenen Taliban sowie die Auseinandersetzungmit der Drogenwirtschaft,dem einzig wirklich funktionierendenWirtschaftszweig, zeigen dieganze Problematik.Wenn man sieht, wie schwer sichDeutschland und der Westen schon indiesen drei Regionen mit ihrer militärischorientierten Sicherheits- undStabilisierungspolitik tun, gibt daskaum eine Blaupause für weitere Länderab, die als Kandidaten in der Warteschlangezukünftiger internationalermilitärischer Interventionen stehenmögen: Damit ist laut VerteidigungsministerStruck potentiell „die ganzeWelt“ 6 gemeint. Dahinter steht diezutreffende Einschätzung, dass sich dieexplosiven Konfliktgebiete im Süden –auch und gerade solche, die uns hierbedrohen – kontinuierlich ausweitenwerden. Trotz aller moralischen Aufrüstung:Eine militärische Interventionspolitikkann und darf hier nicht dieLösung werden, sie würde uns alle –Norden und Süden – tiefer in eineSpirale unerbittlicher Gewalt ziehenund zu Verlierern machen.Es sind diese Fragen, die sich letztlichauch die zivilen Organisationen stellenmüssen, wenn sie über ihre Sicherheitdebattieren oder militärischen Schutzfordern. Bevor sie sich in dieses Bootsetzen, sollten sie angesichts der Sturmwarnungennach- und umdenken, um indiesem Sturm glaubwürdig zu bleibenund nicht mit zu Schiffsbrüchigen zuwerden.5 Aus: „Entwicklungspolitik im Windschattenmilitärischer Interventionen? – gemeinsamesPositionspapier von MISEREOR, EED undBrot für die Welt, 31.7.20036 Verteidigungsminister Struck in der SüddeutschenZeitung vom 14.1.2004: „das möglicheEinsatzgebiet [der Bundeswehr] ist die ganzeWelt.“Social Watch Report Deutschland / 46
- Seite 1: E I N I N T E R N A T I O N A L E R
- Seite 4 und 5: InhaltsverzeichnisSeite4 Vorwort zu
- Seite 6: Vorwort zur internationalen Ausgabe
- Seite 9 und 10: Social Watch DeutschlandKurzinforma
- Seite 11 und 12: Menschliche Sicherheit bedeutet meh
- Seite 13 und 14: die sie durchqueren [...]. Ziele m
- Seite 15 und 16: Agenda 2010: Ein Armutszeugnis?VON
- Seite 17 und 18: Armut und soziale Ausgrenzung in De
- Seite 19 und 20: Migranten, Migrantinnen und ArmutVO
- Seite 21 und 22: Hindernisse für menschliche Sicher
- Seite 24 und 25: Die größten Probleme in diesemBer
- Seite 26 und 27: mus. Der Vertrag sieht einen europ
- Seite 28 und 29: Artikel III-218 des Verfassungsentw
- Seite 30 und 31: Der Zusammenhang zwischen internati
- Seite 32 und 33: waffen des Landes zu entschärfen,
- Seite 34 und 35: Druck von außen wirkt nur kurzfris
- Seite 36 und 37: die für Frauen, die Armen und ande
- Seite 38 und 39: Ungleicher Zugang zu und ungleicheK
- Seite 40 und 41: Die Wurzeln von häuslicher Gewalt
- Seite 42 und 43: eicherung und zur Bedienungklientel
- Seite 44 und 45: Was heißt „Zivile Konfliktbearbe
- Seite 48 und 49: Stagnierende Entwicklungszusammenar
- Seite 50: m TEIL II
- Seite 55 und 56: Tabelle 15: Trends bei der Vergabe
- Seite 57 und 58: (73 %), Somalia (71 %), Afghanistan
- Seite 59 und 60: und Entbindung, das Angebot von Med
- Seite 61 und 62: zur unteren Hälfte der Länder mit
- Seite 63 und 64: politischen und wirtschaftlichen En
- Seite 65 und 66: globalen Einkommens, das heißt, ü
- Seite 67 und 68: das ermöglichte uns die Errechnung
- Seite 69 und 70: 1. Sterblichkeitsrate bei Kindern u
- Seite 71 und 72: Gender: Große Unterschiede zwische
- Seite 73 und 74: Tabelle 1: Die derzeitige Verteilun
- Seite 75 und 76: Tabelle 1: Die derzeitige Verteilun
- Seite 77 und 78: Tabelle 2: GrundbildungDas Recht au
- Seite 79 und 80: Tabelle 2: GrundbildungDas Recht au
- Seite 81 und 82: Tabelle 3a: Gesundheit von KindernD
- Seite 83 und 84: Tabelle 3b: Gesundheit von KindernA
- Seite 85 und 86: Tabelle 3b: Gesundheit von KindernA
- Seite 87 und 88: Tabelle 4: ErnährungssicherungDas
- Seite 89 und 90: Tabelle 4: ErnährungssicherungDas
- Seite 91 und 92: Tabelle 5: Reproduktive GesundheitD
- Seite 94 und 95: Tabelle 5: Reproduktive GesundheitD
- Seite 96 und 97:
Tabelle 6: GesundheitDas Recht auf
- Seite 98 und 99:
Tabelle 6: GesundheitDas Recht auf
- Seite 100 und 101:
Tabelle 7: Zugang zu sauberem Trink
- Seite 102 und 103:
Tabelle 8a: Gleichstellung der Gesc
- Seite 104 und 105:
Tabelle 8a: Gleichstellung der Gesc
- Seite 106 und 107:
Tabelle 8b: Gleichstellung der Gesc
- Seite 108 und 109:
Tabelle 8b: Gleichstellung der Gesc
- Seite 110 und 111:
Tabelle 9: Entwicklung der öffentl
- Seite 112 und 113:
Tabelle 9: Entwicklung der öffentl
- Seite 114 und 115:
Tabelle 10: Information, Wissenscha
- Seite 116 und 117:
Tabelle 10: Information, Wissenscha
- Seite 118 und 119:
Tabelle 11:Unterschriften und Ratif
- Seite 120 und 121:
Tabelle 12: Ratifizierungen der wic
- Seite 122 und 123:
Tabelle 13: Ratifizierungen der wic
- Seite 124 und 125:
Tabelle 14:Status und Fälligkeiten
- Seite 126 und 127:
Tabelle 14:Status und Fälligkeiten
- Seite 128 und 129:
m NOTIZEN