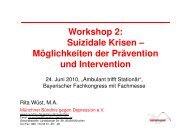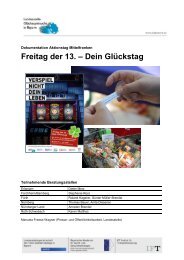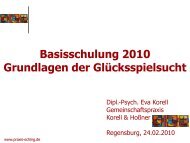Komorbidität bei Pathologischem Glücksspiel - Landesstelle ...
Komorbidität bei Pathologischem Glücksspiel - Landesstelle ...
Komorbidität bei Pathologischem Glücksspiel - Landesstelle ...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
1 Pathologisches <strong>Glücksspiel</strong>en<br />
1.1 Definition nach DSM-IV und ICD-10<br />
M. Sassen<br />
Im Allgemeinen ist unter <strong>Glücksspiel</strong> das Setzen eines Wertes auf ein Spiel/Event oder eine Wette<br />
jeglicher Art zu verstehen, deren Ausgang nicht vorhersagbar ist und <strong>bei</strong> der das Ergebnis zu einem<br />
gewissen Grad vom Zufall abhängt (Bolen & Boyd, 1968). Pathologisches <strong>Glücksspiel</strong>en (PG)<br />
(Pallanti, DeCaria, Grant, Urpe, & Hollander, 2005) stellt ein schwerwiegendes Problem dar, das mit<br />
negativen Konsequenzen für das Individuum, für Personen in dessen Umfeld, aber auch für die Gesellschaft<br />
insgesamt einhergeht (Raylu & Oei, 2002; Raylu & Oei, 2004).<br />
Im ICD-10 (Internationale Klassifikation der Krankheiten, zehnte Revision) ist PG unter „abnorme Gewohnheiten<br />
und Störungen der Impulskontrolle“ (F63) eingeordnet (Weltgesundheitsorganisation<br />
WHO). Hiernach besteht die Störung im häufig wiederholten episodenhaften <strong>Glücksspiel</strong>, das die Lebensführung<br />
der betroffenen Person beherrscht und zum Verfall der sozialen, beruflichen, materiellen<br />
und familiären Werte und Verpflichtungen führt.<br />
Das DSM-IV (Diagnostisches und Statistisches Manual Psychischer Störungen, vierte Version) kategorisiert<br />
PG ebenfalls als eine Störung der Impulskontrolle, die nicht andernorts klassifiziert ist (American<br />
Psychiatric Association, APA 1994). Wesentliches Merkmal von PG ist demnach ein „andauerndes,<br />
wiederkehrendes und maladaptives Spielverhalten, das persönliche, familiäre oder Freizeitbeschäftigungen<br />
stört oder beeinträchtigt“ (APA 1994, S. 615). Dies kann sich unter anderem in starkem<br />
Eingenommensein vom <strong>Glücksspiel</strong>, erfolglosen Einschränkungs- oder Aufgabeversuchen des Spiels,<br />
Unruhe und Gereiztheit da<strong>bei</strong>, Lügen gegenüber Dritten zur Vertuschung der Spielproblematik oder<br />
Wiederaufnahme des <strong>Glücksspiel</strong>s, um Geldverluste auszugleichen, äußern. Werden fünf der insgesamt<br />
zehn Kriterien erfüllt, liegt PG vor.<br />
Als eine schwächere Ausprägung, <strong>bei</strong> der drei bis vier, aber nicht alle für eine Diagnose notwendigen<br />
Kriterien erfüllt werden, kann das so genannte problematische Spielverhalten (PrG) angesehen werden<br />
(z. B. Volberg, Abbott, Ronnberg, & Munck, 2001).<br />
Die diagnostischen Kriterien für PG sind in den Abbildungen 1 und 2 jeweils für das ICD-10 und das<br />
DSM-IV dargestellt.<br />
ICD-10<br />
F63 Abnorme Gewohnheiten und Störungen der Impulskontrolle<br />
F63.0 Pathologisches <strong>Glücksspiel</strong>en<br />
Dauerndes, wiederholtes Spielen<br />
Anhaltendes und oft noch gesteigertes Spielen trotz negativer sozialer Konsequenzen, wie:<br />
- Verarmung<br />
- gestörte Familienbeziehungen<br />
- Zerrüttung der persönlichen Verhältnisse<br />
Abbildung 1: Diagnosekriterien für pathologisches <strong>Glücksspiel</strong>en nach ICD-10<br />
PRAXISHANDBUCH GLÜCKSSPIEL II Basiswissen Seite 1/1