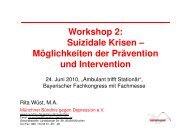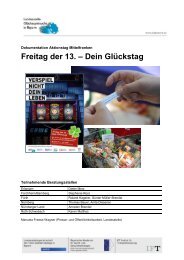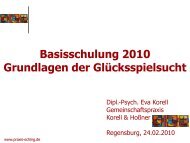Komorbidität bei Pathologischem Glücksspiel - Landesstelle ...
Komorbidität bei Pathologischem Glücksspiel - Landesstelle ...
Komorbidität bei Pathologischem Glücksspiel - Landesstelle ...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
„Verhaltensabhängigkeit“ („behavioral dependence“) oder „Verhaltenssucht“ verwendet. Unterstützt<br />
wird die Diskussion durch Befunde, die zeigen, dass stoffgebundene und stoffungebundene Abhängigkeiten<br />
in dieselben zentralnervösen Verstärker-Mechanismen eingreifen. Zudem wurden die diagnostischen<br />
Kriterien des pathologischen <strong>Glücksspiel</strong>ens <strong>bei</strong> der Aufnahme der Diagnose im DSM-III in<br />
Anlehnung an die Kriterien der stoffgebundenen Sucht (Abhängigkeit von psychotropen Substanzen)<br />
formuliert (Müller-Spahn & Margraf, 2003; Grüsser-Sinopoli, 2008). In dem gemeinsamen einheitlichen<br />
Diagnoseschlüssel der Renten- und Krankenversicherungen ist das pathologische <strong>Glücksspiel</strong>en unter<br />
30791 „Spielsucht" aufgenommen. Auch Betroffene selbst bezeichnen sich überwiegend als „süchtige<br />
Spieler".<br />
1.3 Spielertypologie<br />
M. Sassen<br />
Die meisten Spieler lassen sich einer der folgenden Gruppen zuordnen:<br />
Soziale Spieler<br />
- Größte Gruppe unter<br />
den <strong>Glücksspiel</strong>ern<br />
- Unterhaltung, Freizeitgestaltung<br />
- Kein auffälliges<br />
Spielverhalten<br />
1.4 Epidemiologie<br />
M. Sassen<br />
Professionelle Spieler<br />
- Kleine Gruppe unter<br />
den <strong>Glücksspiel</strong>ern<br />
- Eher im illegalen<br />
Bereich<br />
- Verdienen Lebensunterhalt<br />
mit <strong>Glücksspiel</strong>en<br />
- Distanziertes und<br />
kontrolliertes Verhältnis<br />
zum Spielen<br />
Problematische Spieler<br />
- Sind gefährdet<br />
- Befinden sich in<br />
Übergangsphase<br />
- Merkmale: Schuldgefühle,<br />
erste Vernachlässigung<br />
von Verpflichtungen,<br />
erste<br />
höhere Geldverluste<br />
Pathologische Spieler<br />
- Schwerwiegende<br />
Probleme mit<br />
<strong>Glücksspiel</strong><br />
- Unkontrolliertes<br />
Spielverhalten<br />
(Meyer & Bachmann, 2005)<br />
Das Spielen um Geld ist für eine große Zahl der Deutschen eine gelegentliche oder regelmäßige Form<br />
der weitgehend unproblematischen Unterhaltung und Freizeitgestaltung. Nach einer repräsentativen<br />
Studie im Jahr 2006 (Bühringer, Kraus, Sonntag, Pfeiffer-Gerschel, & Steiner, 2007) haben 71,5% (37<br />
Mio.) der erwachsenen Deutschen bereits einmal in ihrem Leben an einem <strong>Glücksspiel</strong> teilgenommen,<br />
49,4% (25,7 Mio.) spielen da<strong>bei</strong> regelmäßig. Ähnliche Werte zeigen sich in der bayerischen Bevölkerung<br />
im Alter von 18 bis 64 Jahren: Mehr als zwei Drittel (69,2%) hat schon einmal gespielt und etwa<br />
die Hälfte (52,3%) hat in den vergangenen 12 Monaten an einem <strong>Glücksspiel</strong> teilgenommen. Daraus<br />
ergeben sich für Bayern entsprechend folgende Absolutwerte: 5,4 Mio. bzw. 4,1 Millionen (siehe Abschnitt<br />
1.5 <strong>Glücksspiel</strong>verhalten in Bayern).<br />
Weltweite Prävalenzschätzungen von pathologischem <strong>Glücksspiel</strong> (PG) ergeben, dass 0,4% bis 4,7%<br />
der Bevölkerung in den vergangenen zwölf Monaten problematisches Spielverhalten (PrG) gezeigt hat<br />
und 0,15% bis 2,1% sogar pathologisch spielen (Stucki & Rihs-Middel, 2007). In Deutschland liegt<br />
aktuellen Studien zufolge der Anteil der Personen, die in den vorangegangenen zwölf Monaten die<br />
Kriterien für PG nach DSM-IV erfüllten, <strong>bei</strong> ca. 0,2% bis 0,6% der erwachsenen Gesamtbevölkerung<br />
PRAXISHANDBUCH GLÜCKSSPIEL II Basiswissen Seite 1/3