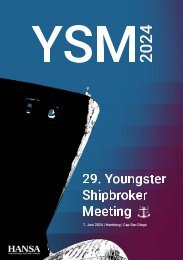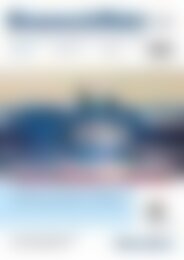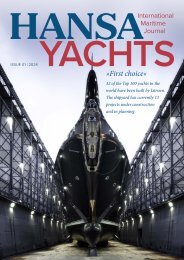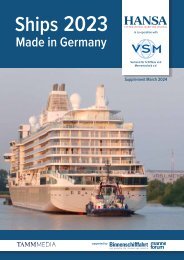Binnenschifffahrt September 2019 – Online-Vorschau
Binnenschifffahrt September 2019 – Online-Vorschau
Binnenschifffahrt September 2019 – Online-Vorschau
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Schiffstechnik<br />
© SGV<br />
ridmotors sind es insgesamt zehn. Dabei<br />
ist der Wago CANopen Controller 750-<br />
837 als Kopf gewählt, der sich in Codesys<br />
programmieren lässt.«<br />
Ein weiterer Vorteil seien die schnelle<br />
Startzeiten: Wird das System eingeschaltet,<br />
sei die Steuerung innerhalb von wenigen<br />
Sekunden betriebsbereit. »Mit dem<br />
CAN-Bus verbinden wir unsere und die<br />
Wago-Steuerung, dann läuft das.«<br />
Die Funktionen des Hybridantriebs<br />
werden über das Softwarewerkzeug IO-<br />
Pro auf Basis von Codesys 2.3 im Wago-<br />
Controller programmiert, »unser Controller<br />
dient dann im Prinzip nur noch als<br />
normales Fernsteuerungsgerät, das Informationen<br />
mit dem Wago-System austauscht«,<br />
erklärt Mudroch.<br />
Alle Kennlinienumschaltungen sind<br />
im 750er-System programmiert, hier<br />
werden Daten ausgewertet und weitergegeben.<br />
Wählt der Kapitän zum Beispiel<br />
den Elektromotor an, bereitet der Controller<br />
den Hybridantrieb auf den Elektromodus<br />
vor. Abhängig von den Anforderungen<br />
kann der Elektromotor dann<br />
als zusätzlicher Schub im Boost-Betrieb<br />
oder als Wellengenerator benutzt werden.<br />
Zudem bereitet die Steuerung analoge<br />
Werte wie die Drehzahl des Dieselmotors<br />
oder die Hebelposition auf. Über<br />
fest im Speicher verankerte Variablen<br />
kann sie aber nicht nur programmiert,<br />
sondern auch parametriert werden <strong>–</strong> Parameter<br />
stellen zum Beispiel dar, wann<br />
Verzögerungszeiten oder andere Funktionalitäten<br />
zum Einsatz kommen sollen,<br />
die an- oder abgeschaltet werden<br />
müssen.<br />
Zwei unterschiedliche Antriebsquellen,<br />
mehr Signale <strong>–</strong> dadurch erhöht sich<br />
entsprechend auch die Anzahl der Fehlermöglichkeiten,<br />
gibt Mudroch zu bedenken:<br />
»Auftretende Fehler müssen von<br />
der Steuerung so behandelt werden, dass<br />
das Schiff den Anforderungen entsprechend<br />
reagiert, zumal für einen Kapitän<br />
bei einem Hybrid nicht sofort ersichtlich<br />
ist, welcher Teil des Antriebs die Fehlermeldung<br />
erzeugt hat.«<br />
Für jeden Modus-Wechsel wird eine<br />
Schrittkette gestartet. Nach jedem<br />
Schritt kontrolliert die Steuerung, ob<br />
er auch vollständig durchgeführt wurde.<br />
»Von den Regeln der Klassifikationsgesellschaften<br />
wird bestimmt, wie sich<br />
das Schiff im Falle eines Fehlers zu verhalten<br />
hat«, erklärt Mudroch. Bei einem<br />
Seeschiff sollte der letzte Fahrzustand bei<br />
einem Fehlerfall möglichst erhalten bleiben,<br />
damit der Schiffsführer entscheiden<br />
kann, ob er weiterfährt oder den Motor<br />
per Notstop ausstellt. Binnenschiffe wie<br />
die »Bürgenstock« wiederum würden<br />
den zügig bei einem Ausfall ausschalten,<br />
»weil sie natürlich relativ schnell in Ufer-<br />
Nähe kämen«, so Mudroch weiter.<br />
Die »Bürgenstock« ist nicht das erste<br />
Schiff mit elektrischem Antrieb, das auf<br />
dem Vierwaldstättersee fährt: Bereits<br />
2017 wurde das Vorgängermodell »Diamant«,<br />
von der SGV in Betrieb genommen.<br />
Dank des leichten Gewichts, der<br />
optimierten Rumpfform und des Hybridantriebs<br />
könne dieses Kurs- und Eventschiff<br />
rund 20% Energie gegenüber einem<br />
konventionellen, dieselbetriebenen<br />
Schiff einsparen, heißt es.<br />
Kein Hilfsdiesel an Bord<br />
Die »Bürgenstock« sei zwar mit ähnlichen<br />
Komponenten wie das Vorgängerschiff<br />
ausgestattet, »wir sind aber noch<br />
ein Schritt innovativer geworden«, erklärt<br />
Mudroch. Ist die »Diamant« mit einem<br />
Hilfsdiesel für die Abdeckung der<br />
sehr hohen Bordnetzlasten versehen <strong>–</strong> im<br />
Speziellen bei großen Events, wurde dieser<br />
bei der Bürgenstock weggelassen: eine<br />
lärm- wie abgasemissionsreduzierende<br />
sowie platzsparende Maßnahme.<br />
Und auch das Prinzip der Antriebssteuerung<br />
stellt eine Weiterentwicklung<br />
dar, unterstreicht der Aventics-Mitarbeiter:<br />
»Beim Vorgänger ist es so gewesen,<br />
dass der Motor erst einmal auf einen<br />
neutralen Zustand gestellt werden musste,<br />
um zwischen den Antriebsmöglichkeiten<br />
zu wechseln. Dieses Umschalten<br />
konnte schon einige Sekunden dauern.«<br />
Elektroantrieb während der Fahrt<br />
Bei der »Bürgenstock« schaltet der Diesel<br />
zum Elektroantrieb während der Fahrt<br />
zu, nachdem der Schiffsführer den Befehl<br />
dazu erteilt hat. »Passagiere bekommen<br />
weder das Umschalten noch Zukuppeln<br />
oder irgendein Ruckeln mit <strong>–</strong> das gleicht<br />
sich alles von der Antriebsseite aus.«, so<br />
Mudroch, für den ein Ende der Entwicklung<br />
noch lange nicht erreicht ist. »Solange<br />
ich mit Wago meine eigene Steuerung<br />
mit Programmen und Ein- und Ausgängen<br />
erweitern kann, ist noch vieles möglich.«<br />
Dies gelte auch für einen künftigen<br />
digitalen Datentransfer zwischen der Steuerung<br />
und einer Cloud: »Einen Remotezugriff<br />
auf das System haben wir noch nicht,<br />
was aber mit den von uns verwendeten,<br />
nicht cloudfähigen Controllern zu tun hat.<br />
Wenn der Kunde die Anforderungen vorgibt,<br />
wäre eine Lösung mit IoT-Controllern<br />
von Wago aber sicher eine Option.«<br />
Neben den Komponenten, die Aventics<br />
in der Hybdridsteuerung der »Bürgenstock«<br />
einsetzt, vertraut das Laatzener<br />
Unternehmen auf weitere Wago-Produkte.<br />
»Wir setzen zum Beispiel Reihenklemmen<br />
der 870er-Serie ein, für künftige<br />
Projekte wollen wir die Top Job S einbauen«,<br />
so Mudroch.<br />
Zudem greift das Unternehmen auf einen<br />
Converter aus der Jumpflex-Serie<br />
857 zurück, um Eingangssignale in passende<br />
Frequenzsignale zu konvertieren. »Wir<br />
haben eine Firmware bekommen, die in<br />
der Form kein anderer hat«, ergänzt Mudroch.<br />
So bräuchte man bei Schiffen mit<br />
Verstellpropellern zum Beispiel nicht nur<br />
lineare Kennlinien, sondern auch Knickkurven,<br />
die einen oder mehrere Stützpunkte<br />
hätten. Eine Anforderung, die in<br />
den Converter einprogrammiert worden<br />
ist. Besonders praktisch: Die Schnittstelle<br />
ist die gleiche wie beim 750er I/O-System.<br />
»Die Zusammenarbeit mit WAGO ist historisch<br />
gewachsen, für uns ist der schnelle<br />
und flexible Support ein Pluspunkt, aber<br />
auch, dass wir beim Einsatz von Komponenten<br />
alles aus einer Hand bekommen<br />
können«, erklärt Mudroch.RD<br />
<strong>Binnenschifffahrt</strong> 09 | <strong>2019</strong><br />
41