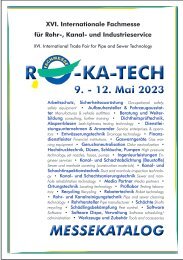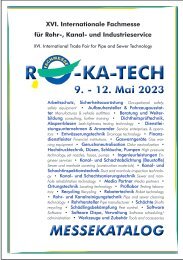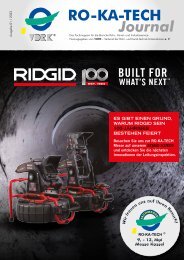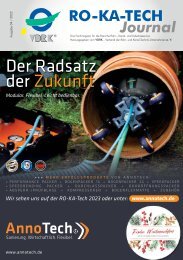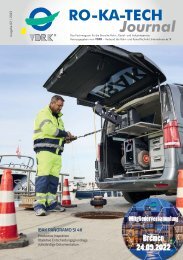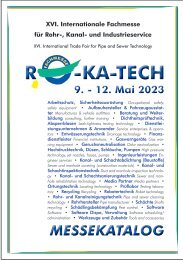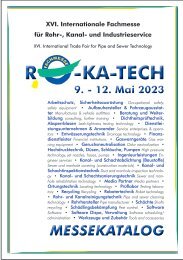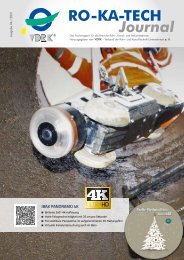Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
VDRK intern - Neues Wasserhaushaltsgesetz<br />
Kommunen und anderen Fachverbände besetzt ist.<br />
Für die Verlängerung des Qualitätspasses ist im Wesentlichen<br />
die positive Bewertung der jährlich einzureichenden Praxisarbeiten<br />
erforderlich. Hierbei wird nicht nur auf die fachgerechte<br />
und zuverlässige Leistung Wert gelegt, sondern auch<br />
besonders auf die Seriosität bei der gesamten ausgeführten<br />
Dienstleistung.<br />
Mit dem Instrument des Qualitätspasses schafft der VDRK nach<br />
eigener Einschätzung erheblichen Nutzen für alle Beteiligten:<br />
Der private Grundstückseigentümer kann sich bei Pass-Inhabern<br />
darauf verlassen, mit hochwertiger und seriöser Arbeit<br />
bedient zu werden. Das Unternehmen wiederum, dessen Arbeitnehmer<br />
mit dem Pass ausgestattet sind, verbessert deutlich<br />
seine Chancen in einem Markt, in dem behördlicherseits und<br />
auch aufgrund der wirtschaftlichen Bedeutung für die Sanierung<br />
immer stärker auf Qualität, Qualifikation und Seriosität<br />
bei der Dichtheitsprüfung geachtet wird. Die mit dem VDRK-<br />
Qualitätspass ausgezeichneten Mitarbeiter dürfen sich mit Fug<br />
und Recht als Elite auf dem Arbeitsmarkt rund um die privaten<br />
Abwasserleitungen betrachten. Verständlich ist auch, dass dieser<br />
Qualitätspass limitiert bleiben wird. Sachkundige gemäß §<br />
61a des NRW Landeswassergesetzes können sich frühestens<br />
nach einem Jahr guter Praxisarbeit bewerben.<br />
VDRK<br />
Verband der Rohr- und Kanal-Technik-Unternehmen e. V.<br />
Ludwig-Erhard-Straße 8<br />
D-34131 Kassel<br />
Telefon: +49 (0) 561/207567-0<br />
Telefax: +49 (0) 561/207567-29<br />
E-Mail: info@vdrk.de<br />
Neues Wasserhaushaltsgesetz in letzter Minute?<br />
Schon zu Beginn der laufenden Legislaturperiode, also vor fast<br />
vier Jahren, hatte Bundesumweltminister Gabriel als vorrangiges<br />
Ziel seiner Umweltpolitik die Schaffung eines einheitlichen<br />
Umweltgesetzbuches ausgegeben. Vor Augen hatte er<br />
dabei die zwölf Sozialgesetzbücher, die praktisch die gesamte<br />
deutsche Sozialgesetzgebung beinhalten. Das deutsche Umweltrecht<br />
hingegen ist heillos zersplittert und für den Nicht-<br />
Spezialisten kaum noch zu durchschauen.<br />
Weitgehend von der Öffentlichkeit unbemerkt hatte Gabriel<br />
schon im Sommer 2007 den Referentenentwurf für ein fünf<br />
Bücher umfassendes Umweltgesetzbuch vorgelegt. Anfangs<br />
schien es so, dass Gabriels Herzensangelegenheit, wenngleich<br />
ein sog. „Zustimmungsgesetz“, das dem Plazet des Bundesrats<br />
bedarf, das parlamentarische Verfahren ohne nennenswerte<br />
Querelen und Verzögerungen durchlaufen würde. Doch dann<br />
formierte sich heftiger Widerstand von gleich zwei Seiten: Zum<br />
einen lief die Wirtschaft unter Federführung des Bundesverbandes<br />
der Industrie (BDI) Sturm gegen das Vorhaben, weil<br />
man erhebliche Verschärfungen von Umweltstandards zu Lasten<br />
der Wirtschaft sah. Zum anderen kam Widerstand aus<br />
mehreren unionsgeführten Bundesländern, die neben der Beeinträchtigung<br />
der Wirtschaft das zu starke Eingriffsrecht des<br />
Bundes zu Lasten der Länder rügten. Vor allem der bayerische<br />
Ministerpräsident Seehofer, Umweltminister Gabriel ohnehin<br />
in herzlicher Abneigung zugetan, ließ kein gutes Haar an dem<br />
geplanten Vorhaben. Da der Umweltminister nicht mehr<br />
rechtzeitig Änderungen vornahm und wohl auch nicht vornehmen<br />
wollte, wurde die schon terminierte Kabinettsabsegnung<br />
unter Leitung der Bundeskanzlerin als Start des parlamentarischen<br />
Durchlaufs kurzfristig abgesagt, und das Umweltgesetzbuch<br />
war damit „gestorben“. Die Verärgerung war allseits<br />
groß, insbesondere die der SPD auf die CDU/CSU. Und dies<br />
auch nicht ganz zu unrecht, denn die von der Union so plötzlich<br />
kritisierten Punkte waren lange vorher bekannt.<br />
So weit so schlecht. Aber ganz aufgeben mochte der<br />
Bundesumweltminister sein Vorhaben denn doch nicht. So<br />
löste man mehrere Komplexe, die als vergleichsweise wenig<br />
umstritten in der Koalition galten, aus dem Entwurf des Umweltgesetzbuches<br />
heraus und brachte sie als vier Einzelgesetze<br />
erneut in das parlamentarische Gesetzgebungsverfahren ein.<br />
Zentrales Einzelgesetz, welches das Bundeskabinett am 4.<br />
März dieses Jahres – diesmal reibungslos – „durchwinkte“,<br />
war das „Gesetz zur Neuregelung des Wasserrechts“ mit einer<br />
gänzlichen Neufassung des altehrwürdigen Wasserhaushaltsgesetzes<br />
(WHG). Das WHG ist ja für die Rohr- und Kanal-<br />
Technik-Unternehmen quasi das Ur-Gesetz ihrer wirtschaftlichen<br />
Betätigung, und Änderungen hierin können durchaus<br />
die Rahmenbedingungen der Branche beeinflussen. Während<br />
die anderen Einzelgesetze voraussichtlich dem sogenannten<br />
„Diskontinuitätsprinzip“ zum Opfer fallen (bis zum Ende der<br />
Legislaturperiode nicht abgeschlossene Gesetzgebungsverfahren<br />
„verfallen“ und müssen, wenn gewollt, in der nächsten<br />
Legislaturperiode ganz neu eingebracht werden), bestehen für<br />
das WHG noch Chancen, bis zur kommenden Bundestagswahl<br />
verabschiedet zu werden.<br />
Die notwendigen Voraussetzungen für ein zügiges Gesetzgebungsverfahren<br />
wurden jedenfalls geschaffen: Der Gesetzentwurf<br />
wurde als „besonders eilbedürftig“ eingestuft, was darin<br />
zum Ausdruck kommt, dass man ihn als sogenanntes „Parallelverfahren“<br />
eingebracht hat. Während Gesetzentwürfe,<br />
die von der Bundesregierung eingebracht werden, im ersten<br />
Schritt dem Bundesrat zur Beratung zugeleitet werden müssen,<br />
können von einer Bundestagsfraktion eingebrachte Gesetzentwürfe<br />
ohne diesen „Umweg“ sofort im Bundestag behandelt<br />
werden. Bundesrat und Bundestag können sich, was natürlich<br />
eine erhebliche Beschleunigung bewirkt, bei einer Paralleleinbringung<br />
praktisch zeitgleich mit einem Gesetzentwurf beschäftigen.<br />
So fand denn auch am 20. März bereits die erste<br />
Lesung im Bundestag statt und schon am 28. April empfahlen<br />
die beteiligten Bundesratsausschüsse dem Plenum des Bundesrats<br />
eine – allerdings mit erheblichen Änderungswünschen<br />
bedachte – Annahme des Gesetzentwurfs. Diesem Votum seiner<br />
Ausschüsse inkl. der vorgeschlagenen Änderungen folgte<br />
der Bundesrat dann auch am 15. Mai.<br />
Gleichwohl: Es wird denkbar knapp, und bis Redaktionsschluss<br />
zu diesem Beitrag war noch nicht absehbar, ob bis zur letzten<br />
Sitzung des Bundestages am 3. Juli und bis zur letzten Sitzung<br />
des Bundesrates sieben Tage später das Gesetzgebungsverfahren<br />
abgeschlossen werden kann.<br />
Was aber sind die wesentlichen Ziele des neuen WHG, welche<br />
Änderungen zum bestehenden WHG sind vorgesehen, und<br />
warum hat es der Gesetzgeber so eilig?<br />
Beginnen wir mit dem Letzteren: Mitte 2006 hatten Bundestag<br />
und Bundesrat nach langwierigen Verhandlungen die „Fö-<br />
RO-KA-TECH Journal <strong>02</strong> / <strong>2009</strong> | 11