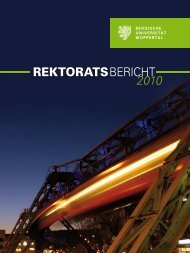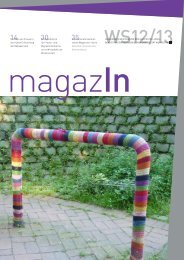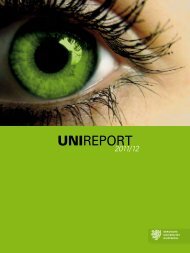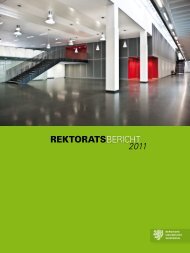magazIn - Bergische Universität Wuppertal
magazIn - Bergische Universität Wuppertal
magazIn - Bergische Universität Wuppertal
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Abb. 1: Erklärungsangebote im Marktmodell<br />
KANDIDATENPOOL<br />
Sozialisation<br />
Sozialstruktur<br />
Abkömmlichkeit<br />
PARTEI / FRAKTION<br />
Diskriminierung<br />
Quoten<br />
Gleichstellungsnormen<br />
REPRÄSENTANZ VON FRAUEN<br />
2. ERKLÄRUNGSMODELL FÜR DIE POLITISCHE UNTERREPRÄSENTANZ VON<br />
FRAUEN Vor der Analyse soll zunächst das vom Mainstream abweichende Er-<br />
klärungsmodell vorgestellt werden. In synthetisierter Form lassen sich vor al-<br />
lem folgende Erklärungsvariablen aus den vorliegenden Studien für Deutsch-<br />
land herausdestillieren:<br />
• Sozialisationsthese: traditionelle Rollenzuweisung,<br />
geringes Politikinteresse etc.<br />
• Abkömmlichkeitsthese: klassische Arbeitsteilung,<br />
mangelndes Zeitbudget.<br />
• Sozialstrukturthese: Frauen sind seltener in Führungspositionen<br />
und erhalten damit geringere Ausgangschancen.<br />
• Diskriminierungsthese: Männer bauen hohe Hürden<br />
für politisch motivierte Frauen auf (z. B. »Ochsentour«).<br />
• Quotenthese: Hohe Quoten bedeuten mehr Frauen in der Politik.<br />
• Wahlrechtsthese: Die Wählerschaft diskriminiert Frauen.<br />
Diese Thesen werden im Folgenden dem Modell des Personalmarktes zugeordnet<br />
(Abb. 1).<br />
Diese Zuordnung ermöglicht die klare Identifizierung von drei Adressaten – die<br />
Frauen als Kandidatenpool (Angebotsseite), die Parteien mit ihren Auswahlkriterien<br />
(Nachfrage- und Angebotsseite) und die Wählerschaft mit ihren Präferenzen<br />
(Nachfrageseite) – und bietet den Vorteil, dass Maßnahmen zielgruppenspezifisch<br />
ansetzen können. Mit diesem Modell ist zugleich ein Perspektivenwechsel<br />
verbunden. Danach ist für die Erklärung der Unterrepräsentanz<br />
von Frauen in Parlamenten nicht mehr so relevant, ob einzelne Frauen aufgrund<br />
sozialer Lagen, der ungleichen Verteilung der Hausarbeit oder aufgrund<br />
eines geringen Interesses an politischen Mandaten als Kandidatinnen zur Verfügung<br />
stehen. Relevant für unser Erklärungsproblem ist, ob es nicht doch für<br />
die Parteien möglich ist, insgesamt genügend Kandidatinnen zu erreichen, um<br />
eine paritätische Zusammensetzung ihrer Listen zu realisieren.<br />
DR. ELKE WIECHMANN PolitisChe UnterrePrÄsentanZ Von fraUen in Der kommUnalPolitik<br />
WAHLRECHT<br />
Wählermarkt<br />
Wahlverhalten<br />
Abb. 2: Entwicklung der Frauenrepräsentanz in<br />
westdeutschen Großstadtparlamenten<br />
35<br />
30<br />
25<br />
20<br />
15<br />
10<br />
5<br />
0<br />
14,8<br />
1980<br />
19,4<br />
1986<br />
27,4<br />
1991<br />
32,3<br />
1996<br />
33,7<br />
2002<br />
33,4<br />
2008<br />
33,4<br />
2010<br />
3. FRAUENREPRÄSENTANZ IN DEN GROSSSTADT-<br />
PARLAMENTEN Unserer These zufolge ist es vor<br />
allem für Großstädte unwahrscheinlich, dass sich<br />
hier Frauen nicht in ausreichendem Maße für die<br />
kommunalen Räte finden lassen. Hier zumindest<br />
könnte man am ehesten annehmen, dass sich rein<br />
statistisch betrachtet und bei entsprechender<br />
Ansprache seitens der Parteien genügend Frauen<br />
(unter mehreren 10.000 Einwohnerinnen) interessieren<br />
und motivieren lassen.<br />
Ein Zeitreihenvergleich zwischen den Jahren 1980<br />
und 2010 zur Entwicklung der Frauenrepräsentanz<br />
in deutschen Großstädten zeigt zunächst einen<br />
kontinuierlichen Anstieg bis ca. Mitte der 1990er<br />
Jahre. Im dann folgenden Jahrzehnt bis heute allerdings<br />
stagniert die Frauenrepräsentanz bei ca.<br />
einem Drittel (Abb. 2).<br />
Schauen wir auf den sprunghaften Anstieg der<br />
Frauen in den Räten ab den 1980er Jahren, dann<br />
sind folgende Ereignisse zu berücksichtigen:<br />
• 1983: Die Grünen ziehen mit ihrer 50 %-Quote<br />
in den Bundestag.<br />
• 1988: Die SPD macht sich auf dem Weg zur<br />
40 %-Quote.<br />
• 1990: Die PDS (LINKE ab 2005) beschließt ihre<br />
50 %-Quote.<br />
• 1996: Die CDU empfiehlt das Quorum (33,3 %).<br />
Offensichtlich haben die Grünen die Parteien unter<br />
Anpassungsdruck gesetzt und waren im Partei-