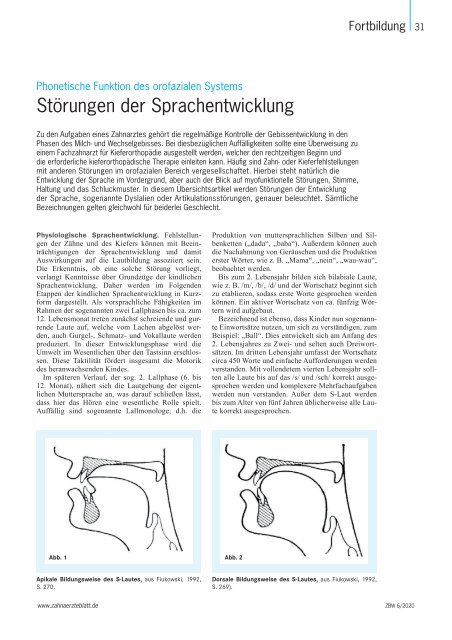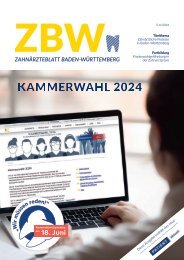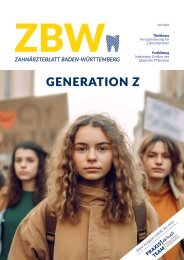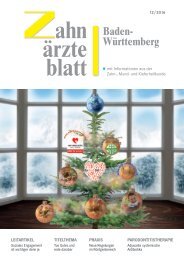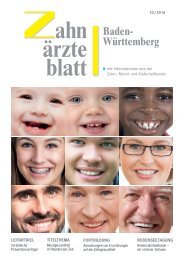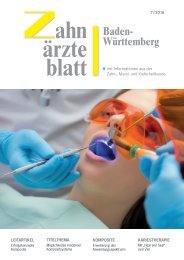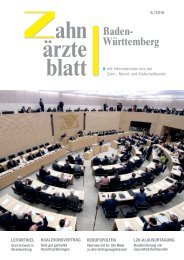… und Standespolitik wirkt doch, Kammerwahl 2020
Ausgabe 6/2020
Ausgabe 6/2020
- Keine Tags gefunden...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Fortbildung 31<br />
Phonetische Funktion des orofazialen Systems<br />
Störungen der Sprachentwicklung<br />
Zu den Aufgaben eines Zahnarztes gehört die regelmäßige Kontrolle der Gebissentwicklung in den<br />
Phasen des Milch- <strong>und</strong> Wechselgebisses. Bei diesbezüglichen Auffälligkeiten sollte eine Überweisung zu<br />
einem Fachzahnarzt für Kieferorthopädie ausgestellt werden, welcher den rechtzeitigen Beginn <strong>und</strong><br />
die erforderliche kieferorthopädische Therapie einleiten kann. Häufig sind Zahn- oder Kieferfehlstellungen<br />
mit anderen Störungen im orofazialen Bereich vergesellschaftet. Hierbei steht natürlich die<br />
Entwicklung der Sprache im Vordergr<strong>und</strong>, aber auch der Blick auf myofunktionelle Störungen, Stimme,<br />
Haltung <strong>und</strong> das Schluckmuster. In diesem Übersichtsartikel werden Störungen der Entwicklung<br />
der Sprache, sogenannte Dyslalien oder Artikulationsstörungen, genauer beleuchtet. Sämtliche<br />
Bezeichnungen gelten gleichwohl für beiderlei Geschlecht.<br />
Physiologische Sprachentwicklung. Fehlstellungen<br />
der Zähne <strong>und</strong> des Kiefers können mit Beeinträchtigungen<br />
der Sprachentwicklung <strong>und</strong> damit<br />
Auswirkungen auf die Lautbildung assoziiert sein.<br />
Die Erkenntnis, ob eine solche Störung vorliegt,<br />
verlangt Kenntnisse über Gr<strong>und</strong>züge der kindlichen<br />
Sprachentwicklung. Daher werden im Folgenden<br />
Etappen der kindlichen Sprachentwicklung in Kurzform<br />
dargestellt. Als vorsprachliche Fähigkeiten im<br />
Rahmen der sogenannten zwei Lallphasen bis ca. zum<br />
12. Lebensmonat treten zunächst schreiende <strong>und</strong> gurrende<br />
Laute auf, welche vom Lachen abgelöst werden,<br />
auch Gurgel-, Schmatz- <strong>und</strong> Vokallaute werden<br />
produziert. In dieser Entwicklungsphase wird die<br />
Umwelt im Wesentlichen über den Tastsinn erschlossen.<br />
Diese Taktilität fördert insgesamt die Motorik<br />
des heranwachsenden Kindes.<br />
Im späteren Verlauf, der sog. 2. Lallphase (6. bis<br />
12. Monat), nähert sich die Lautgebung der eigentlichen<br />
Muttersprache an, was darauf schließen lässt,<br />
dass hier das Hören eine wesentliche Rolle spielt.<br />
Auffällig sind sogenannte Lallmonologe, d.h. die<br />
Produktion von muttersprachlichen Silben <strong>und</strong> Silbenketten<br />
(„dada“, „baba“). Außerdem können auch<br />
die Nachahmung von Geräuschen <strong>und</strong> die Produktion<br />
erster Wörter, wie z. B. „Mama“, „nein“, „wau-wau“,<br />
beobachtet werden.<br />
Bis zum 2. Lebensjahr bilden sich bilabiale Laute,<br />
wie z. B. /m/, /b/, /d/ <strong>und</strong> der Wortschatz beginnt sich<br />
zu etablieren, sodass erste Worte gesprochen werden<br />
können. Ein aktiver Wortschatz von ca. fünfzig Wörtern<br />
wird aufgebaut.<br />
Bezeichnend ist ebenso, dass Kinder nun sogenannte<br />
Einwortsätze nutzen, um sich zu verständigen, zum<br />
Beispiel: „Ball“. Dies entwickelt sich am Anfang des<br />
2. Lebensjahres zu Zwei- <strong>und</strong> selten auch Dreiwortsätzen.<br />
Im dritten Lebensjahr umfasst der Wortschatz<br />
circa 450 Worte <strong>und</strong> einfache Aufforderungen werden<br />
verstanden. Mit vollendetem vierten Lebensjahr sollten<br />
alle Laute bis auf das /s/ <strong>und</strong> /sch/ korrekt ausgesprochen<br />
werden <strong>und</strong> komplexere Mehrfachaufgaben<br />
werden nun verstanden. Außer dem S-Laut werden<br />
bis zum Alter von fünf Jahren üblicherweise alle Laute<br />
korrekt ausgesprochen.<br />
Abb. 1<br />
Abb. 2<br />
Apikale Bildungsweise des S-Lautes, aus Fiukowski, 1992,<br />
S. 270.<br />
Dorsale Bildungsweise des S-Lautes, aus Fiukowski, 1992,<br />
S. 269).<br />
www.zahnaerzteblatt.de<br />
ZBW 6/<strong>2020</strong>