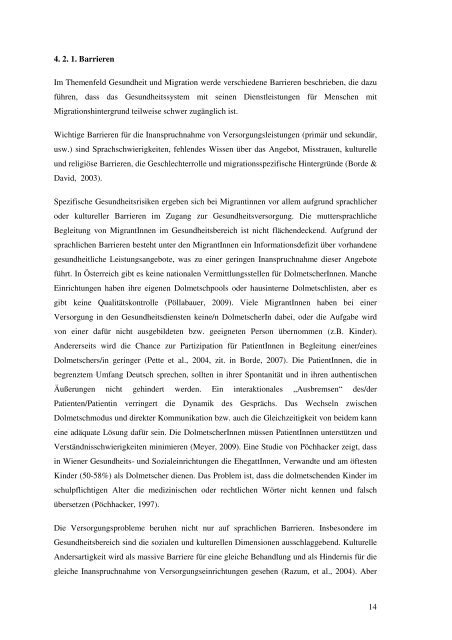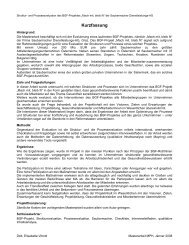Familienplanung bei Migrantinnen in Graz - Wissen ... - Public Health
Familienplanung bei Migrantinnen in Graz - Wissen ... - Public Health
Familienplanung bei Migrantinnen in Graz - Wissen ... - Public Health
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
4. 2. 1. Barrieren<br />
Im Themenfeld Gesundheit und Migration werde verschiedene Barrieren beschrieben, die dazu<br />
führen, dass das Gesundheitssystem mit se<strong>in</strong>en Dienstleistungen für Menschen mit<br />
Migrationsh<strong>in</strong>tergrund teilweise schwer zugänglich ist.<br />
Wichtige Barrieren für die Inanspruchnahme von Versorgungsleistungen (primär und sekundär,<br />
usw.) s<strong>in</strong>d Sprachschwierigkeiten, fehlendes <strong>Wissen</strong> über das Angebot, Misstrauen, kulturelle<br />
und religiöse Barrieren, die Geschlechterrolle und migrationsspezifische H<strong>in</strong>tergründe (Borde &<br />
David, 2003).<br />
Spezifische Gesundheitsrisiken ergeben sich <strong>bei</strong> <strong>Migrant<strong>in</strong>nen</strong> vor allem aufgrund sprachlicher<br />
oder kultureller Barrieren im Zugang zur Gesundheitsversorgung. Die muttersprachliche<br />
Begleitung von MigrantInnen im Gesundheitsbereich ist nicht flächendeckend. Aufgrund der<br />
sprachlichen Barrieren besteht unter den MigrantInnen e<strong>in</strong> Informationsdefizit über vorhandene<br />
gesundheitliche Leistungsangebote, was zu e<strong>in</strong>er ger<strong>in</strong>gen Inanspruchnahme dieser Angebote<br />
führt. In Österreich gibt es ke<strong>in</strong>e nationalen Vermittlungsstellen für DolmetscherInnen. Manche<br />
E<strong>in</strong>richtungen haben ihre eigenen Dolmetschpools oder haus<strong>in</strong>terne Dolmetschlisten, aber es<br />
gibt ke<strong>in</strong>e Qualitätskontrolle (Pöllabauer, 2009). Viele MigrantInnen haben <strong>bei</strong> e<strong>in</strong>er<br />
Versorgung <strong>in</strong> den Gesundheitsdiensten ke<strong>in</strong>e/n DolmetscherIn da<strong>bei</strong>, oder die Aufgabe wird<br />
von e<strong>in</strong>er dafür nicht ausgebildeten bzw. geeigneten Person übernommen (z.B. K<strong>in</strong>der).<br />
Andererseits wird die Chance zur Partizipation für PatientInnen <strong>in</strong> Begleitung e<strong>in</strong>er/e<strong>in</strong>es<br />
Dolmetschers/<strong>in</strong> ger<strong>in</strong>ger (Pette et al., 2004, zit. <strong>in</strong> Borde, 2007). Die PatientInnen, die <strong>in</strong><br />
begrenztem Umfang Deutsch sprechen, sollten <strong>in</strong> ihrer Spontanität und <strong>in</strong> ihren authentischen<br />
Äußerungen nicht geh<strong>in</strong>dert werden. E<strong>in</strong> <strong>in</strong>teraktionales „Ausbremsen“ des/der<br />
Patienten/Patient<strong>in</strong> verr<strong>in</strong>gert die Dynamik des Gesprächs. Das Wechseln zwischen<br />
Dolmetschmodus und direkter Kommunikation bzw. auch die Gleichzeitigkeit von <strong>bei</strong>dem kann<br />
e<strong>in</strong>e adäquate Lösung dafür se<strong>in</strong>. Die DolmetscherInnen müssen PatientInnen unterstützen und<br />
Verständnisschwierigkeiten m<strong>in</strong>imieren (Meyer, 2009). E<strong>in</strong>e Studie von Pöchhacker zeigt, dass<br />
<strong>in</strong> Wiener Gesundheits- und Soziale<strong>in</strong>richtungen die EhegattInnen, Verwandte und am öftesten<br />
K<strong>in</strong>der (50-58%) als Dolmetscher dienen. Das Problem ist, dass die dolmetschenden K<strong>in</strong>der im<br />
schulpflichtigen Alter die mediz<strong>in</strong>ischen oder rechtlichen Wörter nicht kennen und falsch<br />
übersetzen (Pöchhacker, 1997).<br />
Die Versorgungsprobleme beruhen nicht nur auf sprachlichen Barrieren. Insbesondere im<br />
Gesundheitsbereich s<strong>in</strong>d die sozialen und kulturellen Dimensionen ausschlaggebend. Kulturelle<br />
Andersartigkeit wird als massive Barriere für e<strong>in</strong>e gleiche Behandlung und als H<strong>in</strong>dernis für die<br />
gleiche Inanspruchnahme von Versorgungse<strong>in</strong>richtungen gesehen (Razum, et al., 2004). Aber<br />
14