Inhalt - hpd
Inhalt - hpd
Inhalt - hpd
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Bereits an dieser Stelle wird deutlich, dass die Bewältigung dieses Weges an das Vorliegen<br />
bestimmter Voraussetzungen geknüpft ist:<br />
Der sexuelle Missbrauch muss (zumindest im Ansatz) aufgedeckt sein.<br />
Das betroffene Kind, die/der betroffene Jugendliche, aber auch erwachsene Missbrauchsopfer<br />
benötigen zumindest eine stützende und belastbare Vertrauensperson.<br />
Dieser Vertrauensperson bzw. den Betroffenen müssen geeignete Hilfsoptionen<br />
zur Verfügung stehen.<br />
Mangelnde Inanspruchnahme kann auf Defizite in Bezug auf jedes dieser drei Kriterien<br />
zurückgeführt werden. Hier liegen auch die zentralen Erklärungen dafür, dass Betroffene<br />
oft jahrzehntelang keinen Zugang zu Hilfen erhalten. Interventionen zur verbesserten Zugänglichkeit<br />
von Hilfen müssen daher auf alle drei genannten Kriterien abzielen. Dabei ist<br />
durchgängig zu berücksichtigen, dass u. a. Aspekte der Scham und Stigmatisierung die<br />
Hilfesuche erheblich erschweren (Corrigan & Rüsch, 2004) und dass Hilfesuchverhalten<br />
insbesondere im Zusammenhang mit psychischen Belastungen geschlechtsspezifische<br />
Ausprägungen hat (Möller-Leimkühler, 2000). Um Hilfsangebote bedarfsgerecht auszugestalten,<br />
ist es notwendig, darüber Bescheid zu wissen, welche Erwartungen Betroffene<br />
und deren unterstützendes Umfeld an solche Hilfen knüpfen. Aus der Praxis der Arbeit mit<br />
Betroffenen von sexueller Gewalt ist bekannt, dass die Bedürfnislagen so heterogen sind,<br />
dass an dieser Stelle nur eine überblicksartige Auswahl skizziert werden kann:<br />
Verdachtsabklärung;<br />
unmittelbare Krisenintervention im Zusammenhang mit der Aufdeckung;<br />
Angebot sicherer Schutzorte für Betroffene;<br />
Information zu juristischen Belangen;<br />
psychologische/sozialpädagogische Diagnostik und Unterstützung;<br />
(angeleitete) Selbsthilfeangebote für Betroffene;<br />
Angehörigenberatung (Elternberatung, Partnerberatung);<br />
therapeutische Angebote für Betroffene;<br />
Psychoedukation;<br />
Gruppenangebote für Betroffene und Angehörige;<br />
Beratung (und Fallsupervision) von Fachkräften;<br />
Aufbau von fallbezogenen interdisziplinären Kooperationsnetzwerken;<br />
Begleitung zu Institutionen, v. a. Gerichtsbegleitung, Zeuginnen- und Zeugenzimmer;<br />
Videobefragung usw.;<br />
spezifische Angebote für Betroffene von organisierter Kriminalität (Kinderpornografie,<br />
Kinderhandel).<br />
Übergeordnetes Ziel der Klientinnen- und Klientenarbeit von Beratungsstellen ist die psychische<br />
und soziale Stabilisierung der Hilfesuchenden. Psychosoziale Beratungen sind<br />
demnach klar abzugrenzen von Befragungen, in denen es um die – im juristischen Sinne<br />
– Aufklärung von Sachverhalten geht.<br />
Betroffene erwarten, dass solche Angebote von einer grundlegenden Haltung der Parteilichkeit,<br />
der Bereitschaft zur Perspektivübernahme und zur Vertretung ihrer Interessen<br />
getragen werden. Dies impliziert auch, dass Hilfen jeweils den individuellen Bedürfnissen<br />
der Nutzerinnen und Nutzer angepasst werden müssen und nicht in Form von „Standardverfahren“<br />
abgewickelt werden können. Dies ist allein schon deshalb notwendig, weil das<br />
Erleben und die Bewältigung sexueller Gewalt, aber auch das jeweilige Hilfesuch- und<br />
Inanspruchnahmeverhalten je nach Geschlecht, Alter und kulturellem Hintergrund erheblich<br />
variiert.<br />
23


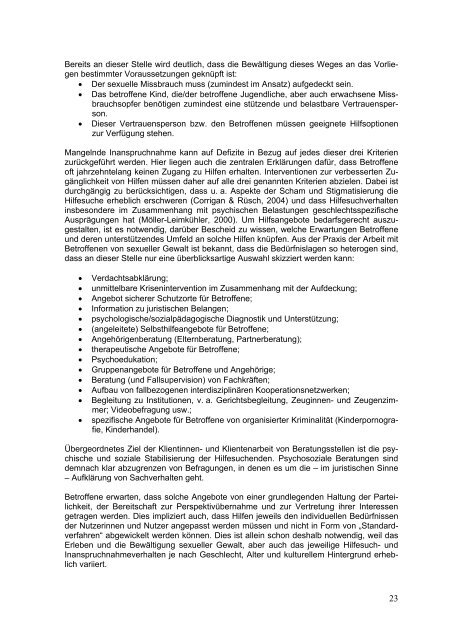
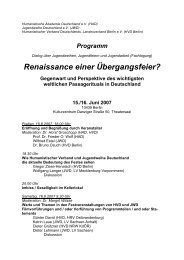

![Regina Eppert an die Bundesregierung 5.02.11[1] - hpd](https://img.yumpu.com/31421910/1/184x260/regina-eppert-an-die-bundesregierung-502111-hpd.jpg?quality=85)




