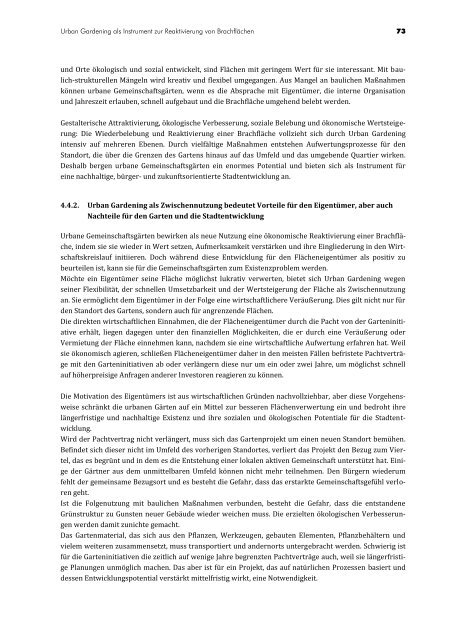Oasen im Beton. Urban Gardening als Instrument zur Attraktivierung ...
Oasen im Beton. Urban Gardening als Instrument zur Attraktivierung ...
Oasen im Beton. Urban Gardening als Instrument zur Attraktivierung ...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
<strong>Urban</strong> <strong>Gardening</strong> <strong>als</strong> <strong>Instrument</strong> <strong>zur</strong> Reaktivierung von Brachflächen 73<br />
und Orte ökologisch und sozial entwickelt, sind Flächen mit geringem Wert für sie interessant. Mit baulich-strukturellen<br />
Mängeln wird kreativ und flexibel umgegangen. Aus Mangel an baulichen Maßnahmen<br />
können urbane Gemeinschaftsgärten, wenn es die Absprache mit Eigentümer, die interne Organisation<br />
und Jahreszeit erlauben, schnell aufgebaut und die Brachfläche umgehend belebt werden.<br />
Gestalterische <strong>Attraktivierung</strong>, ökologische Verbesserung, soziale Belebung und ökonomische Wertsteigerung:<br />
Die Wiederbelebung und Reaktivierung einer Brachfläche vollzieht sich durch <strong>Urban</strong> <strong>Gardening</strong><br />
intensiv auf mehreren Ebenen. Durch vielfältige Maßnahmen entstehen Aufwertungsprozesse für den<br />
Standort, die über die Grenzen des Gartens hinaus auf das Umfeld und das umgebende Quartier wirken.<br />
Deshalb bergen urbane Gemeinschaftsgärten ein enormes Potential und bieten sich <strong>als</strong> <strong>Instrument</strong> für<br />
eine nachhaltige, bürger- und zukunftsorientierte Stadtentwicklung an.<br />
4.4.2. <strong>Urban</strong> <strong>Gardening</strong> <strong>als</strong> Zwischennutzung bedeutet Vorteile für den Eigentümer, aber auch<br />
Nachteile für den Garten und die Stadtentwicklung<br />
<strong>Urban</strong>e Gemeinschaftsgärten bewirken <strong>als</strong> neue Nutzung eine ökonomische Reaktivierung einer Brachfläche,<br />
indem sie sie wieder in Wert setzen, Aufmerksamkeit verstärken und ihre Eingliederung in den Wirtschaftskreislauf<br />
initiieren. Doch während diese Entwicklung für den Flächeneigentümer <strong>als</strong> positiv zu<br />
beurteilen ist, kann sie für die Gemeinschaftsgärten zum Existenzproblem werden.<br />
Möchte ein Eigentümer seine Fläche möglichst lukrativ verwerten, bietet sich <strong>Urban</strong> <strong>Gardening</strong> wegen<br />
seiner Flexibilität, der schnellen Umsetzbarkeit und der Wertsteigerung der Fläche <strong>als</strong> Zwischennutzung<br />
an. Sie ermöglicht dem Eigentümer in der Folge eine wirtschaftlichere Veräußerung. Dies gilt nicht nur für<br />
den Standort des Gartens, sondern auch für angrenzende Flächen.<br />
Die direkten wirtschaftlichen Einnahmen, die der Flächeneigentümer durch die Pacht von der Garteninitiative<br />
erhält, liegen dagegen unter den finanziellen Möglichkeiten, die er durch eine Veräußerung oder<br />
Vermietung der Fläche einnehmen kann, nachdem sie eine wirtschaftliche Aufwertung erfahren hat. Weil<br />
sie ökonomisch agieren, schließen Flächeneigentümer daher in den meisten Fällen befristete Pachtverträge<br />
mit den Garteninitiativen ab oder verlängern diese nur um ein oder zwei Jahre, um möglichst schnell<br />
auf höherpreisige Anfragen anderer Investoren reagieren zu können.<br />
Die Motivation des Eigentümers ist aus wirtschaftlichen Gründen nachvollziehbar, aber diese Vorgehensweise<br />
schränkt die urbanen Gärten auf ein Mittel <strong>zur</strong> besseren Flächenverwertung ein und bedroht ihre<br />
längerfristige und nachhaltige Existenz und ihre sozialen und ökologischen Potentiale für die Stadtentwicklung.<br />
Wird der Pachtvertrag nicht verlängert, muss sich das Gartenprojekt um einen neuen Standort bemühen.<br />
Befindet sich dieser nicht <strong>im</strong> Umfeld des vorherigen Standortes, verliert das Projekt den Bezug zum Viertel,<br />
das es begrünt und in dem es die Entstehung einer lokalen aktiven Gemeinschaft unterstützt hat. Einige<br />
der Gärtner aus dem unmittelbaren Umfeld können nicht mehr teilnehmen. Den Bürgern wiederum<br />
fehlt der gemeinsame Bezugsort und es besteht die Gefahr, dass das erstarkte Gemeinschaftsgefühl verloren<br />
geht.<br />
Ist die Folgenutzung mit baulichen Maßnahmen verbunden, besteht die Gefahr, dass die entstandene<br />
Grünstruktur zu Gunsten neuer Gebäude wieder weichen muss. Die erzielten ökologischen Verbesserungen<br />
werden damit zunichte gemacht.<br />
Das Gartenmaterial, das sich aus den Pflanzen, Werkzeugen, gebauten Elementen, Pflanzbehältern und<br />
vielem weiteren zusammensetzt, muss transportiert und andernorts untergebracht werden. Schwierig ist<br />
für die Garteninitiativen die zeitlich auf wenige Jahre begrenzten Pachtverträge auch, weil sie längerfristige<br />
Planungen unmöglich machen. Das aber ist für ein Projekt, das auf natürlichen Prozessen basiert und<br />
dessen Entwicklungspotential verstärkt mittelfristig wirkt, eine Notwendigkeit.