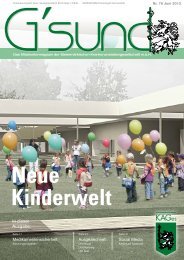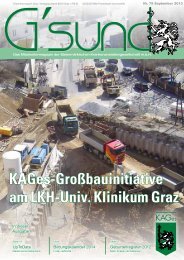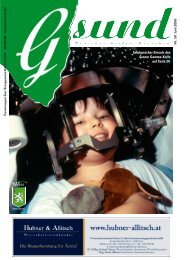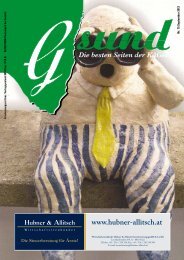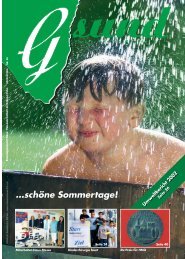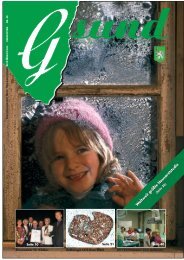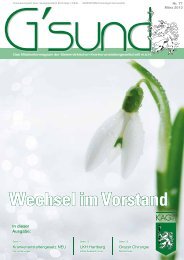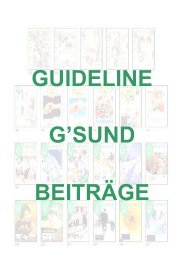PDF-Ausgabe - G'sund.net
PDF-Ausgabe - G'sund.net
PDF-Ausgabe - G'sund.net
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Erzherzog Johann<br />
Ein großzügiger Dienstgeber<br />
Erzherzog Johann, der große<br />
Förderer der Steiermark, verstarb<br />
vor 150 Jahren und in zahlreichen<br />
Veranstaltungen wird<br />
heuer diesem großen Steirer gedacht.<br />
Dieser kleine Beitrag soll<br />
einmal mehr das soziale Engagement<br />
des „Steirischen Prinzen“<br />
belegen.<br />
Bei ihrer Arbeit am Buch über<br />
Anna Plochl, der Ehefrau des Erzherzogs,<br />
stieß Frau Prof. Renate<br />
Basch-Ritter im „Archiv Meran“,<br />
welches sich im Steiermärkischen<br />
Landesarchiv befindet, auf<br />
eine Apothekenrechnung aus dem<br />
Jahre 1858. Freundlicherweise<br />
stellte sie mir diese Rechnung<br />
zur Verfügung. Monat für Monat<br />
waren hier Arzneien aufgelistet,<br />
die das Personal im Palais Meran,<br />
dem Stadtwohnsitz des Erzherzogs,<br />
in der Grazer Apotheke<br />
„Zum guten Hirten“ bezogen hat.<br />
Die Rechnung, mit der ansehnlichen<br />
Summe von 90 Gulden und<br />
81 Kreuzern, wurde zu Ende des<br />
Jahres vom Erzherzog beglichen.<br />
Die Apotheke „Zum guten Hirten“<br />
hatte damals einen anderen<br />
Standplatz als heute (Ecke Leon-<br />
Menschen helfen Menschen<br />
Abbildungen: Steiermärkisches Landesarchiv<br />
Erzherzog<br />
Johann von<br />
Österreich<br />
(nach der natur<br />
gezeich<strong>net</strong><br />
v. Kniehuber<br />
1848).<br />
hardstraße Nr.6/Maiffredygasse).<br />
Sie befand sich im Eckhaus Glacis<br />
Nr. 37/Elisabethstraße. Trotzdem<br />
war sie damals die dem Palais<br />
Meran nächst gelegene.<br />
Auf der Rechnung waren die Verschreibungen<br />
nur recht ungenau<br />
als „Tee“, „Pulver“, „Salbe“ usw.<br />
und auch die Bezieher nur als<br />
„Kammerdiener“, „Gärtner“, „Köchin“<br />
usf. angeführt gewesen.<br />
Das veranlasste mich im „Archiv<br />
Meran“ persönlich nachzusehen.<br />
Groß war die Überraschung, als<br />
dort in einem Kuvert die komplett<br />
erhalten gebliebenen Rezepte<br />
gesammelt vorlagen. Das war<br />
wahrscheinlich jenem glücklichen<br />
Umstand zu verdanken, dass<br />
der Erzherzog im Jahre 1855 für<br />
sein Personal auf seinem Mustergut<br />
Brandhof, auf der Mariazeller<br />
Seite des Seebergs gelegen, eine<br />
sehr hohe Medikamentenrechnung<br />
erhalten hatte. Er schrieb<br />
damals erbost an das Apothekergremium,<br />
er werde künftig nur<br />
jene Rezepte bezahlen, die ihm<br />
vorgelegt werden.<br />
Durch die Volkszähllisten wissen<br />
wir genau Bescheid, wer damals<br />
im Palais Meran beschäftigt war.<br />
Der Haushalt umfasste 22 Personen,<br />
die wir beinahe alle namentlich<br />
kennen. Auf Grund der<br />
gefundenen Rezepte war es nicht<br />
schwer, die einzelnen Arzneien<br />
nun auch den entsprechenden<br />
Personen zuzuordnen. Beinahe<br />
alle haben innerhalb eines Jahres<br />
eine Arznei bezogen.<br />
Aber es waren nicht nur seine<br />
Angestellten, die der Erzherzog<br />
medizinisch versorgen ließ. Seine<br />
Großzügigkeit ging so weit, dass<br />
er auch Medizinen für deren Ehefrauen,<br />
mehrmals sogar für ein<br />
Kind eines Mitarbeiters bezahlt<br />
hat! Nur zwei Rezepte waren auf<br />
ihn selbst ausgestellt gewesen.<br />
Die Sammlung umfasste 144 Rezepte,<br />
wobei viele Rezepte mehrere<br />
Verschreibungen aufwiesen.<br />
Die Rezepte waren in lateinischer<br />
Sprache, meist mit Abkürzungen,<br />
ausgestellt gewesen. Alle waren<br />
sie noch mit Kielfeder, auf<br />
oft schlechtem Papier, in meist<br />
nicht leicht zu entziffernder „Ärzteschrift“<br />
geschrieben worden.<br />
Auch das Verschriebene war<br />
manchmal nicht einfach zu lesen,<br />
weil man heute wenig Vorstellung<br />
hat, was man damals z. B.<br />
unter ein „Schwalbenwasser“,<br />
ein „Wiener Trankl“ oder eine<br />
„Zwetschkenlatwerge“ verstand.<br />
Um unter den Verschreibungen<br />
eine Einteilung zu treffen, wurde<br />
eine Unterteilung der Arzneien<br />
nach ihrer Herstellungsart z. B.<br />
„Pulver“, „Tee“, „Saft“ usw. versucht.<br />
Innerhalb dieser Gruppen<br />
wiederum wurde eine Einteilung<br />
getroffen, wogegen eine Arznei<br />
wirken soll, sofern das überhaupt<br />
möglich war. So konnte man feststellen,<br />
unter welchen Beschwerden<br />
damals Bedienstete eines<br />
herrschaftlichen Haushalts zu<br />
leiden hatten.<br />
Die häufigste Verschreibung war<br />
das „Pulver“, gefolgt von den so<br />
genannten „Mixturen“, dann den<br />
Rezeptbeispiel.<br />
Ölen (z. B. Lebertranöl) und den<br />
„Safterln“. Nie wurden dagegen<br />
„Zäpfchen“ verschrieben.<br />
Und woran litten damals die<br />
Angestellten? Am häufigsten<br />
wurden Abführmittel verschrieben!<br />
Dann folgten Mittel gegen<br />
Husten/Bronchitis, Mittel zur Förderung<br />
der Verdauung und Verschreibungen<br />
gegen Fieber. Insgesamt<br />
konnte ich Mittel gegen<br />
17 unterschiedliche Leiden feststellen.<br />
Zwei Präparate waren für<br />
ein krankes Pferd des Erzherzogs<br />
bestimmt gewesen.<br />
Einmal mehr zeigte diese Apothekenrechnung<br />
die soziale Einstellung<br />
von Erzherzog Johann,<br />
der sich gegenüber seinen Bediensteten<br />
als wahrer Hausvater<br />
im besten Sinne des Wortes erwies.<br />
n<br />
bernd_mader@gmx.at<br />
Erstes Blatt der Sammelrechnung<br />
der „Apotheke zum guten Hirten“.<br />
Juni 2009<br />
PAnORAMA<br />
55