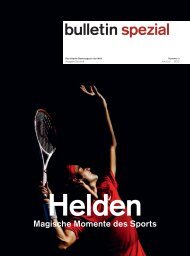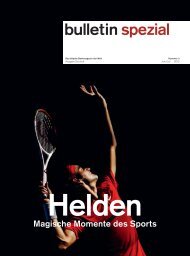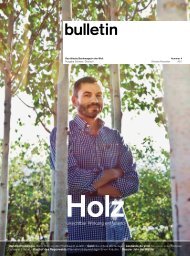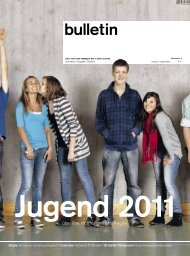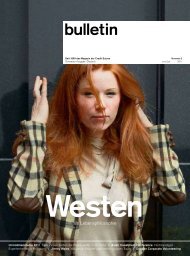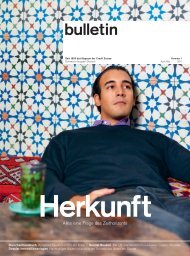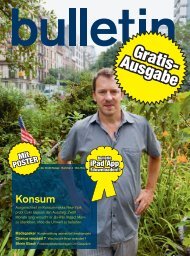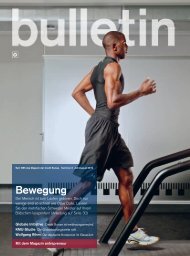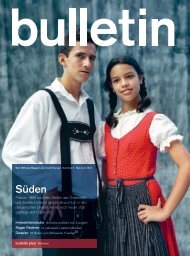bull_01_03_Tradition
Credit Suisse bulletin, 2001/03
Credit Suisse bulletin, 2001/03
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
TRADITION<br />
Es war eine ganz einfache, aber gepflegte, weiss gestrichene<br />
Holzkirche im typisch neuenglischen Stil, in der Estelle und<br />
Hannes heirateten. Und obschon die Festgemeinde nur aus dem<br />
«Town Clerk» des kleinen Dorfes in Vermont und dem Traupaar<br />
aus der Schweiz bestand, gab sich der Pfarrer grösste Mühe, die<br />
Feier würdevoll zu gestalten. Dabei hatte ihn Estelle kurz vor der<br />
Zeremonie noch verärgert, weil sie im Ehegelübde das «...bis der<br />
Tode euch scheidet» herausstreichen wollte.<br />
Eine kirchliche Trauung hatten die beiden allerdings gar nicht<br />
vorgesehen. Doch der Reihe nach: Estelle und Hannes waren<br />
seit langem ein Liebespaar, zögerten aber, diese Liebe in einer<br />
Institution festzuschreiben und so möglicherweise zu ersticken.<br />
Doch auf einer Ferienreise durch Neuengland kam das Thema<br />
Heiraten dann doch nochmals auf – und wurde in einem Moment<br />
grosser Emotionalität mit Ja beantwortet. Und nun wirkte der<br />
Zufall als Beschleuniger. Als sie nämlich im nächsten Dorf tankten,<br />
sahen sie auf der anderen Strassenseite ein Schild mit der Aufschrift<br />
«Town Clerk». «Kann man hier eine Heirat beantragen?»,<br />
fragte Estelle schüchtern. Darauf der angegraute Beamte: «Baby,<br />
you are in the right place!»<br />
Fotos: André Muelhaupt, Pia Zanetti<br />
aus dem Buch «Die Wachsflügelfrau», Evelyn Hasler, Verlag Nagel & Kimche<br />
Die betrogene Mutter<br />
Weil die beiden niemanden in Vermont kannten, aber zwei<br />
Trauzeugen brauchten, organisierte der freundliche Gemeindeschreiber,<br />
der sich netterweise zur Verfügung stellte, auch noch<br />
den Pfarrer seiner Basiskirche, was dieser, ganz pfarrherrlich, so<br />
deutete, dass die beiden auch eine kirchliche Trauung wünschten.<br />
Wieder in der Schweiz stellte Estelle fest – sie war alleine<br />
zurückgereist, während Hannes noch seine Nachdiplomstudien<br />
in den Staaten beendete –, dass ihre Spontanheirat nicht alle<br />
gleichermassen begrüssten. Estelles Mutter verfiel gar in eine<br />
tiefe Depression und warf ihrer Tochter vor, sie nicht nur um<br />
einen grossen Tag, sondern auch um die «Hohe Zeit» vor der<br />
Hochzeit betrogen zu haben: «So etwas macht man nur in ganz<br />
schäbigen Familien!»<br />
Mit dieser Erfahrung ist Estelle nicht alleine. <strong>Tradition</strong>en<br />
brechen, schafft Irritationen, ob das nun das private oder das<br />
öffentliche Leben betrifft. Denn nichts Bequemeres, als sich auf<br />
<strong>Tradition</strong>en zu berufen; <strong>Tradition</strong>en als Weitergabe von Sitten,<br />
Bräuchen und Konventionen. Weitertragen von Althergebrachtem<br />
erfordert keinerlei Legitimation und entbindet von jeglicher Denkarbeit:<br />
Weil es immer so war, muss es immer so bleiben. Der <strong>Tradition</strong>sbruch<br />
und die Ablehnung der damit verbundenen Rituale<br />
ist deshalb oft auch ein Tabubruch – und der wiegt schwer.<br />
Estelle konnte den Schaden in der Familie erst wieder reparieren,<br />
als sie die Taufe ihres Sohnes wie ein traditionelles Hochzeitsfest<br />
zelebrierte.<br />
Dass man mit <strong>Tradition</strong>en nicht ungestraft bricht, haben in der<br />
Geschichte vor allem jene Frauen gespürt, die mit alten Männertraditionen<br />
aufräumen wollten. Allen voran die Vorkämpferinnen<br />
der Frauenrechte, die die Vorherrschaft der Männer in Politik und<br />
<strong>Tradition</strong> Hochzeit: Zwist ist vorprogrammiert<br />
Arbeitswelt anfochten. Ihnen ist Ungeheuerliches widerfahren,<br />
viele sind daran zerbrochen.<br />
Emilie Kempin-Spyri (1853–19<strong>01</strong>) etwa, die weltweit erste<br />
Juristin, musste zwölf Jahre nach ihrem hervorragenden Studienabschluss<br />
(«summa cum laude») um die Stelle einer Dienstmagd<br />
betteln, weil es ihr verunmöglicht wurde, als Juristin zu arbeiten.<br />
Frauen seien als solche in der Berufswelt nicht vorgesehen,<br />
wurde ihr wiederholt beschieden.<br />
Und das Bundesgericht in Lausanne, an das sie sich in ihrer<br />
Verzweiflung wandte, hielt 1887 fest: «Wenn nun die Rekurrentin<br />
zunächst auf Art. 4 der Bundesverfassung («Alle Schweizer<br />
sind vor dem Gesetze gleich», Anm. d. Red.) abstellt und aus<br />
diesem Artikel scheint folgern zu wollen, die Bundesverfassung<br />
postulire die volle rechtliche Gleichstellung der Geschlechter auf<br />
dem Gebiete des gesamten öffentlichen und Privatrechts, so<br />
ist diese Auffassung eben so neu als kühn; sie kann aber nicht<br />
gebilligt werden.»<br />
Nicht viel besser ist es Iris von Roten (1917–1990) ergangen,<br />
die rund siebzig Jahre später gegen die Männervorherrschaft<br />
rebellierte. Sie forderte nicht nur das Recht, als Anwältin tätig<br />
sein zu können, sie wollte zusätzlich eine ganze Reihe von politischen<br />
und gesellschaftlichen Frauenrechten durchsetzen.<br />
In ihrem umfangreichen Emanzipationswerk «Frauen im Laufgitter»<br />
(1958) zeigte sie auf, wie die Frauen hierzulande, weil es<br />
die Sitten und Bräuche angeblich so wollten, dazu verdammt<br />
Credit Suisse<br />
Bulletin 3|<strong>01</strong><br />
21