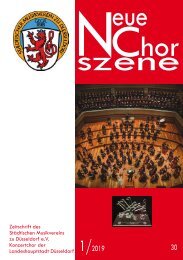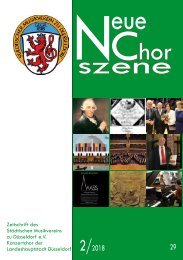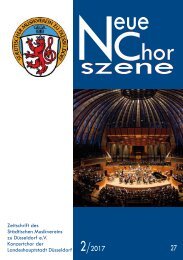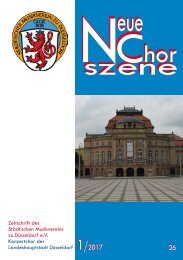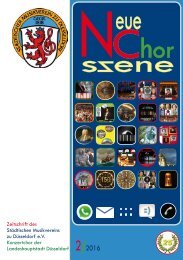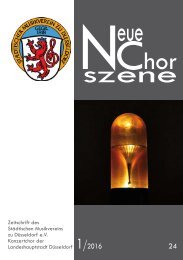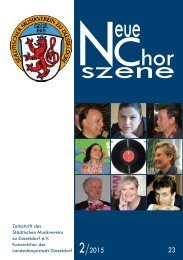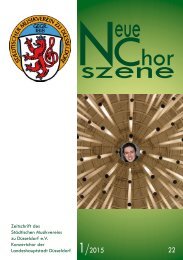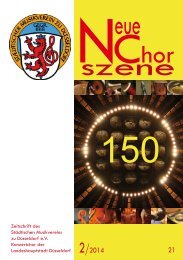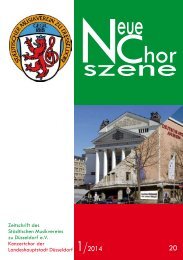NeueChorszene 28 - Ausgabe 1/2018
Zeitschrift des Städtischen Musikvereins zu Düsseldorf e.V. Konzertchor der Landeshauptstadt Düsseldorf
Zeitschrift des Städtischen Musikvereins zu Düsseldorf e.V.
Konzertchor der Landeshauptstadt Düsseldorf
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Sinn und Gemüt. Das Wort ist verdammt<br />
klein, aber es hat es hinter den Ohren, und<br />
ich sage es nicht einem jeden. Aber Du<br />
kannst noch besser werden! Du mußt Dich<br />
mehr zusammennehmen, mehr sammeln,<br />
Du mußt Dich ernster und emsiger zu deinem<br />
eigentlichen Beruf, zum einzigen Beruf<br />
eines Mädchens, zur Hausfrau bilden.<br />
Die wahre Sparsamkeit ist die wahre Liberalität,<br />
wer Geld wegwirft, muß ein Geizhals<br />
oder ein Betrüger werden. Der Frauen<br />
Beruf ist der schwerste, die unausgesetzte<br />
Beschäftigung mit dem Kleinsten, das Auffangen<br />
eines jeden Regentropfens, damit<br />
er nicht in dem Sande verdunste, sondern<br />
zum Bache geleitet, Wohlstand und Segen<br />
verbreite, […]...das, und alles, was Du Dir<br />
dazu denken wirst, sind die Pflichten, die<br />
schweren Pflichten der Frauen.“ 3<br />
Fanny Mendelssohn (1805-1847) hielt<br />
sich zunächst an diese ihr zugedachten<br />
Rolle, nicht jedoch unter Verzicht auf die<br />
musikalische Tätigkeit. Sie komponierte<br />
Klavierstücke und Lieder, eine Oratorium,<br />
eine Ouvertüre. Ihr Ehemann, der Akademiemaler<br />
Wilhelm Hensel, den sie nach<br />
längerer Prüfung heiraten durfte, unterstützte<br />
ihre musikalische Arbeit, ermunterte<br />
sie und wurde so zum idealen Partner<br />
der Komponistin und begabten Pianistin.<br />
Der Italienaufenthalt der Familie Hensel<br />
1839. 1840 brachte eine Veränderung in<br />
der Haltung Fanny Hensels zu ihrer Rolle.<br />
In Rom traf sie auf Mitglieder der französischen<br />
Künstlerkolonie, darunter Charles<br />
Gounod, die sie animierten, zu komponieren<br />
und zu musizieren. An Selbstbewusstsein<br />
gewonnen, begann sie nach ihrer<br />
Rückkehr aus Rom in Berlin ihre Kompositionen<br />
herauszugeben. Dazu schreibt<br />
sie an ihren Bruder Felix: „Eigentlich sollte<br />
ich Dir jetzt gar nicht zumuthen, diesen<br />
Quark zu lesen, beschäftigt wie Du bist,<br />
wenn ich Dir nicht hätte schreiben müs-<br />
3 in: Ute Büchter-Römer: Fanny Mendelssohn-<br />
Hensel, Reinbeck 2001, Seite 31.<br />
sen, um Dir etwas mitzuteilen. Da ich aber<br />
von Anfang an weiß, daß es Dir nicht recht<br />
ist, so werde ich mich etwas ungeschickt<br />
dazu anstellen, denn lache mich aus oder<br />
nicht, ich habe mit 40 Jahren eine Furcht<br />
vor meinen Brüdern, wie ich sie mit 14 vor<br />
meinem Vater gehabt habe, oder vielmehr<br />
Furcht ist nicht das rechte Wort, sondern<br />
der Wunsch, Euch Allen die ich liebe, es in<br />
meinem ganzen Leben recht zu machen,<br />
u wenn ich nun vorher weiß, daß es nicht<br />
der Fall sein wird, so fühle ich mich rather<br />
unbehaglich dabei. Mit einem Wort, ich<br />
fange an herauszugeben, ich habe Herrn<br />
Bock´s treuer Liebeswerbung um meine<br />
Lieder, u seinen vorteilhaften Bedingungen<br />
endlich ein geneigtes Ohr geliehn.<br />
[...] Schande hoffe ich Euch nicht zu machen,<br />
da ich keine u leider<br />
gar kein junges Deutschland bin.“ 4 Dieser<br />
Brief verrät eine Wandlung der Komponistin.<br />
Sie fügt sich nicht mehr dem Postulat,<br />
als Komponistin nur „zur Zierde des<br />
Hauses“ zu komponieren. Zu herzlich und<br />
ehrlich war die Anerkennung, die ihr in Italien<br />
gezollt wurde. Sie fand ihre „Nische“,<br />
ihre musikalische Aufgabe. Da Felix Mendelssohn<br />
als Gewandhauskapellmeister in<br />
Leipzig vollauf beschäftigt war, hatte sie<br />
die Leitung der halböffentlichen „Sonntagsmusiken“<br />
auf der Leipziger Strasse 3<br />
in Berlin übernommen. Diese entwickelten<br />
sich zu einem Treffpunkt Musik interessierter<br />
Menschen, die sich nicht nur aus Berlin<br />
auch zu Diskussionen zusammenfanden.<br />
Fanny Hensel hat diese Tätigkeit genossen.<br />
Wilhelm Hensel saß dabei und zeichnete<br />
alle Gäste, und dokumentierte so,<br />
wer dort alles zu Gast war. Wie glücklich<br />
die Komponistin über diese Konzerte war,<br />
geht aus einem Brief an ihre Schwester<br />
Rebecka vom 18. März 1844 hervor: „Vorigen<br />
Sonntag war bei uns die brillanteste<br />
Sonntagsmusik, die, glaube ich, noch jemals<br />
stattgefunden hat, sowohl was Aus-<br />
4 in: Ute Büchter-Römer: Fanny Mendelssohhn-<br />
Hensel, Reinbeck 2001, Seite 48-49.<br />
NC<strong>28</strong> Seite 15