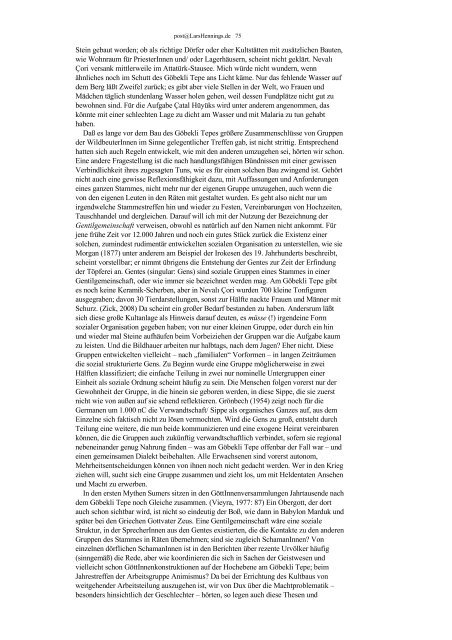Göbekli Tepe PDF - Lars Hennings
Göbekli Tepe PDF - Lars Hennings
Göbekli Tepe PDF - Lars Hennings
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
post@<strong>Lars</strong><strong>Hennings</strong>.de 75<br />
Stein gebaut worden; ob als richtige Dörfer oder eher Kultstätten mit zusätzlichen Bauten,<br />
wie Wohnraum für PriesterInnen und/ oder Lagerhäusern, scheint nicht geklärt. Nevalı<br />
Çori versank mittlerweile im Attatürk-Stausee. Mich würde nicht wundern, wenn<br />
ähnliches noch im Schutt des <strong>Göbekli</strong> <strong>Tepe</strong> ans Licht käme. Nur das fehlende Wasser auf<br />
dem Berg läßt Zweifel zurück; es gibt aber viele Stellen in der Welt, wo Frauen und<br />
Mädchen täglich stundenlang Wasser holen gehen, weil dessen Fundplätze nicht gut zu<br />
bewohnen sind. Für die Aufgabe Çatal Hüyüks wird unter anderem angenommen, das<br />
könnte mit einer schlechten Lage zu dicht am Wasser und mit Malaria zu tun gehabt<br />
haben.<br />
Daß es lange vor dem Bau des <strong>Göbekli</strong> <strong>Tepe</strong>s größere Zusammenschlüsse von Gruppen<br />
der WildbeuterInnen im Sinne gelegentlicher Treffen gab, ist nicht strittig. Entsprechend<br />
hatten sich auch Regeln entwickelt, wie mit den anderen umzugehen sei, hörten wir schon.<br />
Eine andere Fragestellung ist die nach handlungsfähigen Bündnissen mit einer gewissen<br />
Verbindlichkeit ihres zugesagten Tuns, wie es für einen solchen Bau zwingend ist. Gehört<br />
nicht auch eine gewisse Reflexionsfähigkeit dazu, mit Auffassungen und Anforderungen<br />
eines ganzen Stammes, nicht mehr nur der eigenen Gruppe umzugehen, auch wenn die<br />
von den eigenen Leuten in den Räten mit gestaltet wurden. Es geht also nicht nur um<br />
irgendwelche Stammestreffen hin und wieder zu Festen, Vereinbarungen von Hochzeiten,<br />
Tauschhandel und dergleichen. Darauf will ich mit der Nutzung der Bezeichnung der<br />
Gentilgemeinschaft verweisen, obwohl es natürlich auf den Namen nicht ankommt. Für<br />
jene frühe Zeit vor 12.000 Jahren und noch ein gutes Stück zurück die Existenz einer<br />
solchen, zumindest rudimentär entwickelten sozialen Organisation zu unterstellen, wie sie<br />
Morgan (1877) unter anderem am Beispiel der Irokesen des 19. Jahrhunderts beschreibt,<br />
scheint vorstellbar; er nimmt übrigens die Entstehung der Gentes zur Zeit der Erfindung<br />
der Töpferei an. Gentes (singular: Gens) sind soziale Gruppen eines Stammes in einer<br />
Gentilgemeinschaft, oder wie immer sie bezeichnet werden mag. Am <strong>Göbekli</strong> <strong>Tepe</strong> gibt<br />
es noch keine Keramik-Scherben, aber in Nevalı Çori wurden 700 kleine Tonfiguren<br />
ausgegraben; davon 30 Tierdarstellungen, sonst zur Hälfte nackte Frauen und Männer mit<br />
Schurz. (Zick, 2008) Da scheint ein großer Bedarf bestanden zu haben. Andersrum läßt<br />
sich diese große Kultanlage als Hinweis darauf deuten, es müsse (!) irgendeine Form<br />
sozialer Organisation gegeben haben; von nur einer kleinen Gruppe, oder durch ein hin<br />
und wieder mal Steine aufhäufen beim Vorbeiziehen der Gruppen war die Aufgabe kaum<br />
zu leisten. Und die Bildhauer arbeiten nur halbtags, nach dem Jagen? Eher nicht. Diese<br />
Gruppen entwickelten vielleicht – nach „familialen“ Vorformen – in langen Zeiträumen<br />
die sozial strukturierte Gens. Zu Beginn wurde eine Gruppe möglicherweise in zwei<br />
Hälften klassifiziert; die einfache Teilung in zwei nur nominelle Untergruppen einer<br />
Einheit als soziale Ordnung scheint häufig zu sein. Die Menschen folgen vorerst nur der<br />
Gewohnheit der Gruppe, in die hinein sie geboren werden, in diese Sippe, die sie zuerst<br />
nicht wie von außen auf sie sehend reflektieren. Grönbech (1954) zeigt noch für die<br />
Germanen um 1.000 nC die Verwandtschaft/ Sippe als organisches Ganzes auf, aus dem<br />
Einzelne sich faktisch nicht zu lösen vermochten. Wird die Gens zu groß, entsteht durch<br />
Teilung eine weitere, die nun beide kommunizieren und eine exogene Heirat vereinbaren<br />
können, die die Gruppen auch zukünftig verwandtschaftlich verbindet, sofern sie regional<br />
nebeneinander genug Nahrung finden – was am <strong>Göbekli</strong> <strong>Tepe</strong> offenbar der Fall war – und<br />
einen gemeinsamen Dialekt beibehalten. Alle Erwachsenen sind vorerst autonom,<br />
Mehrheitsentscheidungen können von ihnen noch nicht gedacht werden. Wer in den Krieg<br />
ziehen will, sucht sich eine Gruppe zusammen und zieht los, um mit Heldentaten Ansehen<br />
und Macht zu erwerben.<br />
In den ersten Mythen Sumers sitzen in den GöttInnenversammlungen Jahrtausende nach<br />
dem <strong>Göbekli</strong> <strong>Tepe</strong> noch Gleiche zusammen. (Vieyra, 1977: 87) Ein Obergott, der dort<br />
auch schon sichtbar wird, ist nicht so eindeutig der Boß, wie dann in Babylon Marduk und<br />
später bei den Griechen Gottvater Zeus. Eine Gentilgemeinschaft wäre eine soziale<br />
Struktur, in der SprecherInnen aus den Gentes existierten, die die Kontakte zu den anderen<br />
Gruppen des Stammes in Räten übernehmen; sind sie zugleich SchamanInnen? Von<br />
einzelnen dörflichen SchamanInnen ist in den Berichten über rezente Urvölker häufig<br />
(sinngemäß) die Rede, aber wie koordinieren die sich in Sachen der Geistwesen und<br />
vielleicht schon GöttInnenkonstruktionen auf der Hochebene am <strong>Göbekli</strong> <strong>Tepe</strong>; beim<br />
Jahrestreffen der Arbeitsgruppe Animismus? Da bei der Errichtung des Kultbaus von<br />
weitgehender Arbeitsteilung auszugehen ist, wir von Dux über die Machtproblematik –<br />
besonders hinsichtlich der Geschlechter – hörten, so legen auch diese Thesen und