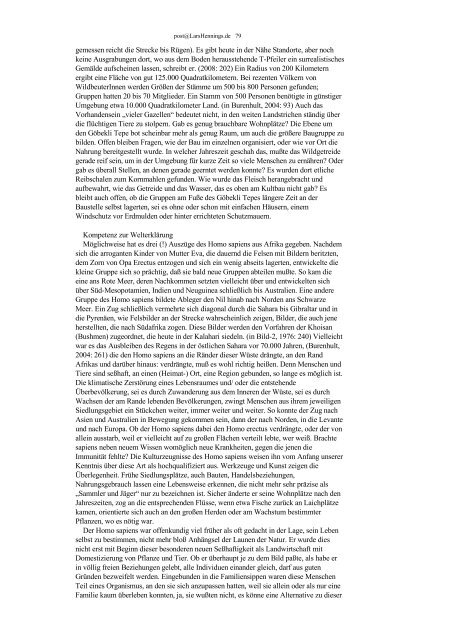Göbekli Tepe PDF - Lars Hennings
Göbekli Tepe PDF - Lars Hennings
Göbekli Tepe PDF - Lars Hennings
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
post@<strong>Lars</strong><strong>Hennings</strong>.de 79<br />
gemessen reicht die Strecke bis Rügen). Es gibt heute in der Nähe Standorte, aber noch<br />
keine Ausgrabungen dort, wo aus dem Boden herausstehende T-Pfeiler ein surrealistisches<br />
Gemälde aufscheinen lassen, schreibt er. (2008: 202) Ein Radius von 200 Kilometern<br />
ergibt eine Fläche von gut 125.000 Quadratkilometern. Bei rezenten Völkern von<br />
WildbeuterInnen werden Größen der Stämme um 500 bis 800 Personen gefunden;<br />
Gruppen hatten 20 bis 70 Mitglieder. Ein Stamm von 500 Personen benötigte in günstiger<br />
Umgebung etwa 10.000 Quadratkilometer Land. (in Burenhult, 2004: 93) Auch das<br />
Vorhandensein „vieler Gazellen“ bedeutet nicht, in den weiten Landstrichen ständig über<br />
die flüchtigen Tiere zu stolpern. Gab es genug brauchbare Wohnplätze? Die Ebene um<br />
den <strong>Göbekli</strong> <strong>Tepe</strong> bot scheinbar mehr als genug Raum, um auch die größere Baugruppe zu<br />
bilden. Offen bleiben Fragen, wie der Bau im einzelnen organisiert, oder wie vor Ort die<br />
Nahrung bereitgestellt wurde. In welcher Jahreszeit geschah das, mußte das Wildgetreide<br />
gerade reif sein, um in der Umgebung für kurze Zeit so viele Menschen zu ernähren? Oder<br />
gab es überall Stellen, an denen gerade geerntet werden konnte? Es wurden dort etliche<br />
Reibschalen zum Kornmahlen gefunden. Wie wurde das Fleisch herangebracht und<br />
aufbewahrt, wie das Getreide und das Wasser, das es oben am Kultbau nicht gab? Es<br />
bleibt auch offen, ob die Gruppen am Fuße des <strong>Göbekli</strong> <strong>Tepe</strong>s längere Zeit an der<br />
Baustelle selbst lagerten, sei es ohne oder schon mit einfachen Häusern, einem<br />
Windschutz vor Erdmulden oder hinter errichteten Schutzmauern.<br />
Kompetenz zur Welterklärung<br />
Möglichweise hat es drei (!) Auszüge des Homo sapiens aus Afrika gegeben. Nachdem<br />
sich die arroganten Kinder von Mutter Eva, die dauernd die Felsen mit Bildern beritzten,<br />
dem Zorn von Opa Erectus entzogen und sich ein wenig abseits lagerten, entwickelte die<br />
kleine Gruppe sich so prächtig, daß sie bald neue Gruppen abteilen mußte. So kam die<br />
eine ans Rote Meer, deren Nachkommen setzten vielleicht über und entwickelten sich<br />
über Süd-Mesopotamien, Indien und Neuguinea schließlich bis Australien. Eine andere<br />
Gruppe des Homo sapiens bildete Ableger den Nil hinab nach Norden ans Schwarze<br />
Meer. Ein Zug schließlich vermehrte sich diagonal durch die Sahara bis Gibraltar und in<br />
die Pyrenäen, wie Felsbilder an der Strecke wahrscheinlich zeigen, Bilder, die auch jene<br />
herstellten, die nach Südafrika zogen. Diese Bilder werden den Vorfahren der Khoisan<br />
(Bushmen) zugeordnet, die heute in der Kalahari siedeln. (in Bild-2, 1976: 240) Vielleicht<br />
war es das Ausbleiben des Regens in der östlichen Sahara vor 70.000 Jahren, (Burenhult,<br />
2004: 261) die den Homo sapiens an die Ränder dieser Wüste drängte, an den Rand<br />
Afrikas und darüber hinaus: verdrängte, muß es wohl richtig heißen. Denn Menschen und<br />
Tiere sind seßhaft, an einen (Heimat-) Ort, eine Region gebunden, so lange es möglich ist.<br />
Die klimatische Zerstörung eines Lebensraumes und/ oder die entstehende<br />
Überbevölkerung, sei es durch Zuwanderung aus dem Inneren der Wüste, sei es durch<br />
Wachsen der am Rande lebenden Bevölkerungen, zwingt Menschen aus ihrem jeweiligen<br />
Siedlungsgebiet ein Stückchen weiter, immer weiter und weiter. So konnte der Zug nach<br />
Asien und Australien in Bewegung gekommen sein, dann der nach Norden, in die Levante<br />
und nach Europa. Ob der Homo sapiens dabei den Homo erectus verdrängte, oder der von<br />
allein ausstarb, weil er vielleicht auf zu großen Flächen verteilt lebte, wer weiß. Brachte<br />
sapiens neben neuem Wissen womöglich neue Krankheiten, gegen die jenen die<br />
Immunität fehlte? Die Kulturzeugnisse des Homo sapiens weisen ihn vom Anfang unserer<br />
Kenntnis über diese Art als hochqualifiziert aus. Werkzeuge und Kunst zeigen die<br />
Überlegenheit. Frühe Siedlungsplätze, auch Bauten, Handelsbeziehungen,<br />
Nahrungsgebrauch lassen eine Lebensweise erkennen, die nicht mehr sehr präzise als<br />
„Sammler und Jäger“ nur zu bezeichnen ist. Sicher änderte er seine Wohnplätze nach den<br />
Jahreszeiten, zog an die entsprechenden Flüsse, wenn etwa Fische zurück an Laichplätze<br />
kamen, orientierte sich auch an den großen Herden oder am Wachstum bestimmter<br />
Pflanzen, wo es nötig war.<br />
Der Homo sapiens war offenkundig viel früher als oft gedacht in der Lage, sein Leben<br />
selbst zu bestimmen, nicht mehr bloß Anhängsel der Launen der Natur. Er wurde dies<br />
nicht erst mit Beginn dieser besonderen neuen Seßhaftigkeit als Landwirtschaft mit<br />
Domestizierung von Pflanze und Tier. Ob er überhaupt je zu dem Bild paßte, als habe er<br />
in völlig freien Beziehungen gelebt, alle Individuen einander gleich, darf aus guten<br />
Gründen bezweifelt werden. Eingebunden in die Familiensippen waren diese Menschen<br />
Teil eines Organismus, an den sie sich anzupassen hatten, weil sie allein oder als nur eine<br />
Familie kaum überleben konnten, ja, sie wußten nicht, es könne eine Alternative zu dieser