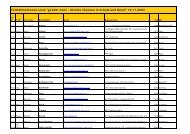chancengleichheit im pflegebereich - gendernow......gender ...
chancengleichheit im pflegebereich - gendernow......gender ...
chancengleichheit im pflegebereich - gendernow......gender ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Die mangelnde Anerkennung durch den Arbeitgeber zeigt sich manchmal auch nur in Kleinigkeiten –<br />
wenn MitarbeiterInnen nicht das gesetzlich vorgeschriebene Kilometergeld bekommen, oder ihre<br />
unpraktische weiße Dienstkleidung ständig selbst auf eigene Kosten in der Freizeit waschen müssen oder<br />
viele Terminkoordinationen und Informationsweitergaben selbstverständlich in der Freizeit per Telefon<br />
passieren, dann fühlen sich MitarbeiterInnen von ihrem Arbeitgeber wenig geschätzt. Es wird auch<br />
darauf hingewiesen, dass die Beschäftigten Fortbildungen meistens selbst bezahlen und in ihrer Freizeit<br />
besuchen müssen.<br />
Körperliche Belastungen / mangelnde Hilfsmittel<br />
Ein zentrales Problemfeld in der mobilen Pflege sind körperliche Belastungen. Vor allem die Frauen<br />
erleben das Alleine-Arbeiten oft als anstrengend, etwa wenn sie KundInnen heben müssen. Man kann<br />
dazu zwar best<strong>im</strong>mte Techniken lernen, aber trotzdem haben laut Anita Amon viele PflegerInnen<br />
Rückenprobleme oder Schulterschmerzen, wenn sie länger in der Pflege arbeiten. Clara Cerny betont,<br />
dass Frauen stärker unter physische Belastungen leiden als Männer.<br />
Technische Hilfsmittel können die Hauskrankenpflege erleichtern. Laut Anita Amon sind Pflegebetten<br />
zwar mittlerweile Standard aber Ressourcen wie Patientenlifter fehlen oft. Im Extremfall gibt es sogar<br />
nicht einmal fließendes Wasser, wie Birgit Beer und Clemens Christ berichten:<br />
„Also wenn mir jemand, bevor ich in der Hauskrankenpflege gearbeitet habe, erzählt hätte, dass es<br />
solche sozialen Zustände noch gibt, hätte ich gesagt: Nie <strong>im</strong> Leben!“(Birgit Beer, 17)<br />
Um die Beschaffung sämtlicher Materialien, Utensilien und Gerätschaften, die zur Pflege dahe<strong>im</strong> nötig<br />
sind, müssen sich die PflegerInnen kümmern, sofern diese nicht von den Angehörigen zur Verfügung<br />
gestellt werden. Dies ist einerseits mühsam, andererseits stößt man auch manchmal an die finanziellen<br />
Grenzen der KundInnen und Angehörigen. Wenn Hilfsmittel nicht leistbar sind und die Krankenkassa<br />
eine Bewilligung ablehnt, sind die PflegerInnen gefordert, sich anders zu helfen. Außerdem müssen sich<br />
Pflegepersonen mit den baulichen Rahmenbedingungen bei den KundInnen zu Hause arrangieren. Und<br />
die sind manchmal nicht opt<strong>im</strong>al. Bruno Binder erwähnt in diesem Zusammenhang als Beispiel zu enge<br />
Duschen.<br />
Mangelnde gesellschaftliche Anerkennung, wie sie zuvor schon angesprochen wurde, drückt sich auch<br />
durch Bewilligungen der öffentlichen Hand aus. Wenn Krankenkassen Hilfsmittel für die mobile Pflege<br />
nicht bewilligen mit der Begründung, diese würden nicht den PatientInnen sondern nur der Pflegeperson<br />
helfen, gewinnen die Beschäftigten nicht unbedingt den Eindruck, ihre Arbeit würde geschätzt: „Von<br />
den Krankenkassen wird so gut wie nichts mehr bewilligt, wegen der Sparmaßnahmen. Ein Krankenbett<br />
bekommt man für zu Hause nur mehr ganz ganz selten, weil in der Ablehnung steht dann drinnen, das<br />
dient nicht dem Patienten sondern der Erleichterung der Pflege, das heißt, das Krankenbett ist eigentlich<br />
für mich und nicht für den Patienten.“ (Bruno Binder: 12)<br />
Warum die Krankenkassa die PflegerInnen nicht mehr dabei unterstützt, die Rahmenbedingungen ihrer<br />
Arbeit zu verbessern ist vor allem deshalb unverständlich, weil einerseits die mobile Pflege für die<br />
Krankenkassen noch <strong>im</strong>mer viel günstiger kommt als die stationäre und andererseits körperliche<br />
Beeinträchtigungen der Pflegepersonen auch bei der Krankenkassa zu Buche schlagen.<br />
Psychische Belastungen<br />
Die Frage der Abgrenzung wurde früher schon erwähnt. Sie stellt sich in der Hauskrankenpflege noch<br />
brisanter als in der stationären Pflege, da der Kontakt mit der Familie der KundInnen enger ist und<br />
PflegerInnen auch gefordert sind, bei Konflikten zwischen Angehörigen und KundInnen zu vermitteln.<br />
<strong><strong>gender</strong>now</strong>: Chancengleichheit <strong>im</strong> Pflegebereich. Wien, Nov. 2006. www.<strong><strong>gender</strong>now</strong>.at<br />
56