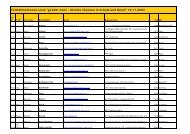chancengleichheit im pflegebereich - gendernow......gender ...
chancengleichheit im pflegebereich - gendernow......gender ...
chancengleichheit im pflegebereich - gendernow......gender ...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Von manchen PflegerInnen werden die Angehörigen als anstren<strong>gender</strong> als die KundInnen beschrieben,<br />
da sie sich oft einmischen und über die KundInnen best<strong>im</strong>men. Hier die Grenzen der Zuständigkeiten zu<br />
finden, fällt manchen Pflegepersonen schwer:<br />
“… und psychisch ist es doch sehr häufig, dass man sich in das Familienumfeld reinziehen läßt, also<br />
das, was ich auch mit Grenzen ziehen und setzen gemeint habe, dass man das auch lernen muss <strong>im</strong><br />
psychischen Bereich auch einmal nein zu sagen, das ist nicht meine Verantwortung, also da sehe ich<br />
<strong>im</strong>mer wieder, dass sich manche zu sehr hineinziehen lassen, also das sind so die größeren<br />
Belastungen“(Anita Amon: 7)<br />
Birgit Beer und Belinda Banner beschreiben die Verantwortung in der Hauskrankenpflege auch deshalb<br />
als größer, weil sie sich für das gesamte Umfeld der KundInnen mitverantwortlich fühlen, wenn diese<br />
alleinstehend sind. Dann geht es nicht mehr nur um die Körperpflege, sondern dann kümmern sich<br />
PflegerInnen oft auch darum, dass KundInnen etwas zu essen haben, die Rechnungen gezahlt werden<br />
und ein neuer Kühlschrank angeschafft wird. PflegerInnen sehen sich also gefordert, neben ihrem Beruf<br />
auch sozialarbeiterische Fähigkeiten zu entwickeln.<br />
Außerdem kann der Umgang mit sturen KundInnen schwierig sein und es fällt PflegerInnen nicht <strong>im</strong>mer<br />
leicht, sich durchzusetzen, wie Clara Cerny beschreibt:<br />
„Ein wesentlicher Unterschied zu einem Krankenhaus sind Krisen und Konfliktgespräche. Wir sind<br />
zuhause der Gast des Kunden. Wenn du Patientin <strong>im</strong> Krankenhaus bist, bist du der Gast des<br />
Krankenhauses. Und das möchte ich sehen, wie oft da sich wirklich Patienten <strong>im</strong> Krankenhaus völlig<br />
offen beschweren und sagen: ‚Ich möchte nicht das Abendessen um 17 Uhr!’.“(Clara Cerny: 23)<br />
Interessant scheint, dass nur Clara Cerny Überforderungen durch die Konfrontation mit Krankheit und<br />
Tod anspricht, die sie vor allem bei jungen MitarbeiterInnen erlebt hat. Da alle InterviewpartnerInnen<br />
älter als 35 Jahre sind, nehmen wir an, dass der Umgang mit dieser Thematik für PflegerInnen mit<br />
steigendem Alter selbstverständlicher wird. Bruno Binder betont aber, dass Abschalten nach der Arbeit<br />
essenziell ist, da man tagtäglich mit kranken und sterbenden Menschen arbeitet.<br />
Zur Bewältigung psychischer Belastungen in der Hauskrankenpflege würde sich Belinda Banner<br />
Supervision oder Coaching wünschen, allerdings stehen dafür in ihrer Organisation nur zwei Stunden <strong>im</strong><br />
Jahr zur Verfügung. Einige InterviewpartnerInnen berichten auch, dass Supervision beantragt werden<br />
müsse und einem Eingeständnis gleichkommt, das Team könne Probleme nicht bewältigen, mit denen<br />
andere sehr wohl ohne Unterstützung fertig würden.<br />
Christian Cech erzählt aus seinem Team, dass es kaum Supervision gibt, weil unter seinen Kolleginnen<br />
eigentlich kein Interesse besteht, sich wirklich intensiv miteinender auseinander zu setzen, wenn es<br />
Schwierigkeiten gibt. Damit widerspricht er genau den Erfahrungen von Birgit Beer und Beate Bacher,<br />
die eher Männer als „Supervisionsverhinderer“ erlebt haben, weil sie seltener zugeben, überlastet zu sein<br />
und sich seltener Hilfe holen. „Ich höre es ja auch bei uns <strong>im</strong>mer wenn man das anspricht, Supervision<br />
oder so, die bringen das ins Lächerliche:“(Beate Bacher: 18)<br />
Hohe Flexibilitätsanforderungen<br />
Die flexiblen Arbeitszeiten werden von vielen InterviewpartnerInnen als Vorteil der mobilen Pflege<br />
genannt, nicht zuletzt um Beruf und Familie besser vereinbaren zu können. Bei näherem Nachfragen<br />
entpuppt sich diese Flexibilität aber auch manchmal als Belastung. Birgit Beer erzählt beispielsweise,<br />
dass die Dienstplanung auf Grund von Urlauben und Krankenständen meist nur auf dem Papier bestehe,<br />
und dass ihr auffalle, dass die meisten Frauen ein schlechtes Gewissen ihren Familien gegenüber hätten,<br />
was sie von Männern unterscheidet.<br />
<strong><strong>gender</strong>now</strong>: Chancengleichheit <strong>im</strong> Pflegebereich. Wien, Nov. 2006. www.<strong><strong>gender</strong>now</strong>.at<br />
57