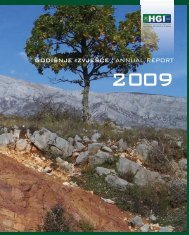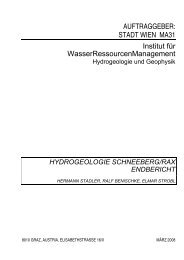Final Report - KATER
Final Report - KATER
Final Report - KATER
- TAGS
- kater
- ccwaters.eu
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Endbericht Vegetationsszenarien – Quelleneinzugsgebiete der Stadt Wien<br />
1. EINLEITUNG<br />
Der Trinkwasserbedarf der Stadt Wien wird zu 95% aus Karstquellen der Nordöstlichen Kalkalpen<br />
gedeckt. Da Karstaquifere eine besonders geringe Filterleistung aufweisen, sind sie im Vergleich zu<br />
Porengrundwässern in viel höherem Maß durch im Infiltrationsgebiet anfallende Schadstoffe gefährdet<br />
(Ford & Willams 1996; Iqbal & Krothe 1995; Plagnes & Bakalowicz 1999). Für den<br />
Karstwasserschutz sind daher die Vegetations- und Bodendecke von besonderer Bedeutung, weil sie<br />
das einzige effektive Filtersystem darstellen (z.B. Huntoon 1997).<br />
Vegetations- und Bodendecke können durch menschliche Nutzungseingriffe verändert werden. In den<br />
Einzugsgebieten der Wiener Hochquellleitungen haben vor allem die Forst- und die Almwirtschaft<br />
eine Jahrhunderte lange Tradition. Almwirtschaftliche Nutzung hat besonders in den Hochlagen die<br />
Flächenanteile von Wald-, Gebüsch- und Rasenvegetation stark beeinflusst. In den letzten 150 Jahren<br />
hat sich die Almbewirtschaftung zunehmend auf Gunstlagen zurückgezogen. Die weitere Entwicklung<br />
wird von den almwirtschaftlichen Rahmenbedingungen abhängen, ein weiterer Rückgang ist<br />
zumindest nicht auszuschließen. Die forstwirtschaftliche Nutzung unterliegt heute großteils der<br />
direkten Einflussnahme der Gemeinde Wien als größtem Waldbesitzer in den Quelleinzugsgebieten.<br />
Auch die Waldbewirtschaftung hat sich in den letzten Jahrzehnten grundlegend verändert. Das<br />
Kahlschlagverbot innerhalb der Quellenschutzwälder der Stadt Wien wurde in der letzten Hälfte des<br />
vorigen Jahrhunderts formuliert, danach folgten weitere wirksame Richtlinien zur Bewirtschaftung der<br />
Quellenschutzwälder. Bestandesaufbau und Baumartenverteilung in den Waldbeständen werden sich<br />
in der Folge verändern.<br />
Für die kommenden Jahrzehnte ist eine einschneidende Veränderung der globalen und regionalen<br />
Klimaverhältnisse prognostiziert (Watson et al. 2001, Lexer et al. 2001). Es wird allgemein erwartet,<br />
dass ansteigende Temperaturen zu einer Arealverschiebung vieler Pflanzenarten, in<br />
Gebirgsökosystemen insbesondere zu einer Höhenverschiebung der Obergrenzen ihres Vorkommens<br />
führen werden (z.B. Grabherr et al. 1995, Walther et al. 2001). Eine wahrscheinliche Folge davon wird<br />
ein Höherwandern der Waldgrenze auf Kosten alpiner Vegetationstypen sein (Aber et al. 2001,<br />
Theurillat & Guisan 2001). Über den zeitlichen und räumlichen Ablauf dieser Prozesse ist man bis<br />
heute großteils auf Spekulationen angewiesen. Diese Unsicherheiten sind einerseits durch die<br />
beträchtlichen Schwankungsbreiten aktueller Klimaprognosen bedingt. Andererseits ist auch mit einer<br />
beträchtlichen regionalen Variabilität zu rechnen, eine Folge der spezifischen naturräumlichen und<br />
biologischen Ausgangsbedingungen. Dementsprechend haben Forschungen über die Auswirkungen<br />
rezenter Erwärmungstrends des letzten Jahrhunderts auf die Waldgrenze zu stark divergierenden<br />
Ergebnissen geführt (vgl. z.B. Kullmann 1993, Lavoie & Payette 1994, Szeicz & MacDonald 1995,<br />
Hessl & Baker 1997, Meshinev et al. 2000, Paulsen et al. 2000, Cullen et al. 2001, Didier 2001, Masek<br />
2001, Motta & Nola 2001, Sturm 2001, Klasner & Fagre 2002, Kullmann 2002).<br />
Eine zusätzliche Komplikation entsteht, wo klimatische Verhältnisse und Bewirtschaftungsformen<br />
sich gleichzeitig verändert haben oder verändern werden und beide Prozesse die Vegetation in<br />
ähnlicher Weise beeinflussen. Das ist insbesondere im Waldgrenzbereich der europäischen Alpen der<br />
Fall, wo während des letzten Jahrhunderts sowohl der Rückgang der Almbewirtschaftung als auch die<br />
Temperaturerhöhung zu einem Vordringen des Waldes in zuvor gehölzfreie Bereiche geführt haben.<br />
Eine kausale Interpretation der rezenten Vegetationsdynamik kann hier große Probleme bereiten<br />
(Didier 2001, Motta & Nola 2001). Dementsprechend ist es schwierig, verlässliche Prognosen über<br />
mögliche zukünftige Entwicklungen zu erstellen.<br />
Im montanen bis subalpinen Waldgürtel ist die Situation insofern eine andere, als durch die fast<br />
flächendeckende forstwirtschaftliche Nutzung die Vegetations- und Bodenentwicklung in viel<br />
höherem Ausmaß der direkten menschlichen Einflussnahme unterliegen. Nicht Fortsetzung oder<br />
Aufgabe der Bewirtschaftung sind im Waldbereich die wesentlichen Zukunftsszenarien sondern die<br />
5