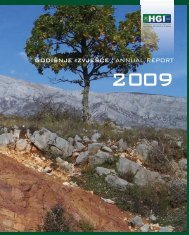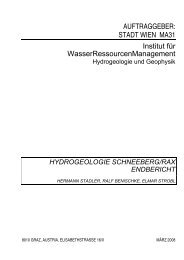Final Report - KATER
Final Report - KATER
Final Report - KATER
- TAGS
- kater
- ccwaters.eu
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Endbericht Vegetationsszenarien – Quelleneinzugsgebiete der Stadt Wien<br />
Erosionsprozesse. Ein Geländemodell bildet daher eine Grundvoraussetzung für eine flächendeckende<br />
Beschreibung der natürlichen Standortsbedingungen. Für dieses Projekt wurde ein Digitales<br />
Höhenmodell (DGM) des Bundesamtes für Eich- und Vermessungwesen verwendet. Es handelt sich<br />
dabei um Rasterdaten mit einer Maschenweite von 20 Metern und zusätzlichen Informationen über<br />
den Verlauf von Geländekanten.<br />
Aus dem DGM wurden direkt Daten zu den Hangneigungsverhältnissen übernommen. Des weiteren<br />
wurden zwei topographische Indizes abgeleitet. Der Erosionsindex EROS beschreibt die Verteilung<br />
des Bodenserosions- und Akkumulationspotentials im Gelände, der Bodenfeuchteindex WET die<br />
topographisch bedingten Unterschiede in den Bodenfeuchteverhältnissen. Beide Indizes wurden mit<br />
Hilfe des Programmpakets TAPES-G (Gallant & Wilson 1996) berechnet.<br />
Darüberhinaus wurde das DGM zur Ableitung der im folgenden beschriebenen Standortsvariablen<br />
benutzt.<br />
3.2.1.2 Klimadaten<br />
Um räumliche Klimaparameter abzuleiten wurden folgende metereologische Daten herangezogen:<br />
Monatswerte (seit 1961) aller Stationen der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik im<br />
Arbeitsgebiet und seiner näheren Umgebung.<br />
Messwerte dreier Stationen von M. Steinkellner (unpubliziert) auf der Schneealpe.<br />
Messwerte der im Rahmen des Projektes installierten Stationen auf der Raxalpe.<br />
Temperaturtage (= Summer der Tage pro Jahr mit Tagesmittelwerten > 0 °C) und Niederschlagswerte<br />
wurden statistisch mit Seehöhe und geographischer Breite korreliert und über multiple<br />
Regressionsverfahren auf die Gesamtfläche des Arbeitsgebietes extrapoliert. An Niederschlagswerten<br />
wurde ausschließlich der Mittelwert des Monats August verwendet und gemeinsam mit der<br />
Solarstrahlung und der entsprechenden Monatsmitteltemperatur (für August) zur Berechnung der<br />
Wasserbilanz herangezogen. Zur Berechnung der topographisch stark variablen Globalstrahlung (Nord<br />
– Südexposition, Horizontüberhöhung, lokale, reliefbedingte Beschattung) wurden ein<br />
Strahlungsmodell und das DGM verwendet. Eine detaillierte Darstellung der Kalkulation der<br />
Klimaparameter ist in Appendix Nr. 1 zu finden.<br />
3.2.1.3 Schneeverteilung<br />
Die Schneeverteilung stellt einen Schlüsselfaktor für die Verbreitung von alpinen Pflanzenarten dar.<br />
Durch die Arbeiten zur Schneeschmelzdynamik auf der Schneealpe (Jansa et al. 2000) waren<br />
ausgezeichnete Grundlagendaten, nämlich klassifizierte Satellitenbilder vorhanden. Diese<br />
Schneeverteilungskarten decken allerdings nur einen Teil des Arbeitsgebietes ab (Schneealpe, Teile<br />
der Raxalpe). Für die Extrapolation auf das Gesamtgebiet wurde ein eigenes Verfahren entwickelt. Die<br />
aufwendige Methodik ist in Appendix Nr. 1 beschrieben.<br />
3.2.1.4 Geologie<br />
Die chemische Zusammensetzung des Muttergesteins und seiner Verwitterungsprodukte ist ein<br />
wichtiger Selektionsfilter für Pflanzenarten. Als Grundlagendaten für dieses Projekt wurden die im<br />
Rahmen des Karstforschungsprogramms der Stadt Wien neu erstellten geologischen Karten<br />
(Geologische Bundesanstalt, unpubliziert) herangezogen. Für fehlende Bereiche auf der Schneealpe<br />
wurde eine Kompilation älterer geologischer Datensätze übernommen (Heinz-Arvand et al. 1997). Aus<br />
den sehr detaillierten petrologische Informationen dieser Karten wurde in Zusammenarbeit mit Dr. G.<br />
Bryda (Geologische Bundesanstalt) ein vereinfachtes 5-stufiges Schema abgeleitet, das die für die<br />
Vegetation wenig relevanten Unterschiede ausfiltert. Differenziert wurde dabei zwischen reinen<br />
Kalken, tonig verwitterenden Kalke, reinen Dolomiten, tonig verwitternden Dolomiten und rezenten<br />
Lockersedimenten (Schuttkörper, Schwemmkegel, Bergstürze, Moränenmaterial).<br />
3.2.1.5 Böden<br />
Der charakteristische Bodentyp in den subalpinen und alpinen Gebieten der Kalkalpen sind<br />
verschiedene Varianten der Rendzina-Serie (Moderrendzina, Polsterrendzina, Tangelrendzina, usw.),<br />
9