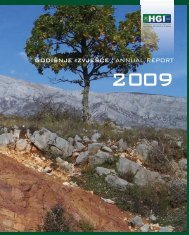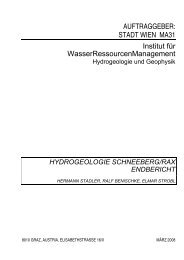Final Report - KATER
Final Report - KATER
Final Report - KATER
- TAGS
- kater
- ccwaters.eu
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Endbericht Vegetationsszenarien – Quelleneinzugsgebiete der Stadt Wien<br />
technischen Innovationen und wissenschaftlichen Erkenntnissen der letzten Jahrzehnte ergeben haben.<br />
Die geänderten Ziele und Verfahren einer quellenschutzorientierten Waldbewirtschaftung sind auch<br />
bei möglichen klimatischen Veränderungen zu gewichten. Die Szenarien der Waldentwicklung<br />
vergleichen demnach Varianten ohne waldbauliche Eingriffe mit Varianten, wo waldbauliche<br />
Strategien zum Einsatz kommen, die eine Optimierung des Quellenschutzes zum Ziel haben. Als<br />
weiteres Szenario werden auch mögliche klimatische Veränderungen in ihrer Wirkung auf die<br />
Waldentwicklung einbezogen.<br />
Die hydrologische Bedeutung von Waldvegetation wurde in zahlreichen Studien dargestellt (Reynolds<br />
et al. 1992, Herwitz & Slye 1995, Likens & Bormann 1995, Hager & Holzmann 1997, Katzensteiner<br />
2000, Rothe et al. 1998, v. Wilpert et al. 2000). Im Zuge des Forschungsprojektes wurden auf der<br />
Raxalpe Messstationen eingerichtet, die durch Vergleiche zwischen verschiedenen Klassen von<br />
Waldvegetation oder zwischen Latschenvegetation und Almvegetation Basisdaten zur Ableitung von<br />
hydrologischen Trends liefern. Durch Zusammenschau von Literaturdaten und eigenen<br />
Messergebnissen können Richtlinien zur Quellenschutzwaldbewirtschaftung untermauert<br />
beziehungsweise neu definiert werden. Wie in den Hochlagen wurden auch im Wald hydrologisch<br />
homogenen Flächeneinheiten (Hydrotop oder hydrological response unit, Gurtz et al. 1999) definiert,<br />
um flächenrelevante Aussagen zu erhalten. Zwei flächendeckende und eine repräsentative Kartierung<br />
schufen die Grundlage zur Hydrotop-Ausscheidung, wobei diese Gliederung auch funktionale<br />
Einheiten für ähnliche waldbauliche Managementmaßnahmen schuf. Die Definition von verfeinerten<br />
und spezifischen Management-Richtlinien zur Optimierung des Quellenschutzes wurde auf die<br />
verschiedenen Hydrotope bezogen durchgeführt und erlangt dadurch auch eine räumlich explizite<br />
Dimension.<br />
2. ARBEITSGEBIET<br />
2.1 Hochlagen<br />
Das Arbeitsgebiet des „Hochlagenteiles“ umfasst die subalpinen und alpinen Gebiete von Schneeberg,<br />
Rax, Schneealpe, Zeller Staritzen und Hochschwab, also einen großen Teil der Einzugsgebiete der I.<br />
und II. Wiener Hochquellleitung. Es handelt sich um eine Gesamtfläche von ca 150 km², die von<br />
alpinen Rasen, Schutt- und Felsvegetation, Latschenkrummholz und den obersten Ausläufern<br />
subalpiner Fichten und Lärchenwäldern bedeckt werden. Die naturräumlichen Verhältnisse und<br />
Details der aktuellen Vegetation sind in den Berichten und Publikationen zum Projekt<br />
„Vegetationskartierung in den Hochlagen der Wiener Hochquelleinzugsgebiete“ ausführlich<br />
dokumentiert worden (Greimler & Dirnböck 1996, Dirnböck & Greimler 1997, Dirnböck 1998,<br />
Dirnböck et al. 1999, Dullinger et al. 2001).<br />
2.2 Waldgürtel<br />
Das Arbeitsgebiet des „Waldteiles“ umfasst den montanen bis hochmontan-subalpinen Bereich des<br />
Fronbachgrabens und den montanen Bereich der Fuchspassquelle, welche den südwestlichen Abhang<br />
des Schneeberges darstellen, sowie den hochmontan-subalpinen Bereich des Kuhschneeberges. Die<br />
zwei ersten Teileinzugsgebiete sind großflächig von Fichten-Tannen-Buchen-Wäldern und<br />
kleinflächiger von Sonder-Waldgesellschaften (Bergahorn-Eschen-Wälder, Kiefernwälder, etc.)<br />
bestockt. Der Kuhschneeberg wird von hochmontanen Fichten-Tannen-Buchen-Waldgesellschaften<br />
und von subalpinen Fichten-(Tannen)-Waldgesellschaften bedeckt. Alle drei Bereiche stellen<br />
Teileinzugsgebiete der I. Wiener Hochquellenwasserleitung dar. Detaillierte Angaben zur<br />
Waldvegetation sind in den Berichten zur forstlichen Standortskartierung (Weidinger & Mrkvicka<br />
2001, Fraissl 1997, Gatterbauer et al. 1996, Köck et al. 2002) nachzulesen.<br />
7