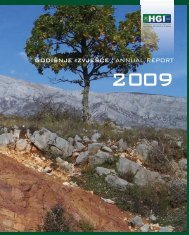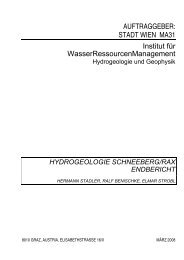Final Report - KATER
Final Report - KATER
Final Report - KATER
- TAGS
- kater
- ccwaters.eu
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Endbericht Vegetationsszenarien – Quelleneinzugsgebiete der Stadt Wien<br />
und somit zu erhöhtem Bewirtschaftungsaufwand (häufiges Schwenden) führt, hat der<br />
Nutzungsverzicht auf solchen Flächen kaum wirtschaftliche Einbußen zur Folge.<br />
Wo aus Managementsicht an günstigen Latschen-Standorten aktuell keine Latschen vorkommen, ist<br />
mit Naturverjüngung kurz- bis mittelfristig nicht in jedem Fall zu rechnen. Die Ergebnisse dieser<br />
Studie haben gezeigt, dass die Naturverjüngung der Latsche vor allem durch zwei Faktoren<br />
kontrolliert wird: Eine räumlich relativ eingeschränkte Samenverbreitung und Konkurrenzhemmung<br />
der Keimung und Keimlingsetablierung in dichten und hohen Rasen- oder Hochstaudenbeständen. Die<br />
Ansamung verläuft optimal auf offenen Rohbodenstandorten im Nahbereich von bereits existierenden<br />
Latschengebüschen. Wo diese Bedingungen nicht gegeben sind, kann die natürliche Etablierung von<br />
Latschengebüschen über Jahrzehnte bis Jahrhunderte fehlen. In solchen Fällen, wenn also die nächsten<br />
samenproduzierenden Latschenbestände mehr als 100-200 Meter entfernt sind oder die aktuelle<br />
Vegetation von dichten und hochwüchsigen Rasen gebildet wird, wäre die gezielte Pflanzung von<br />
Latschen eine sinnvolle Quellschutzstrategie.<br />
Im Hinblick auf die wahrscheinliche Klimaerwärmung ist eine völlige Aufgabe der Almwirtschaft vor<br />
allem aus Naturschutzgründen keine empfehlenswerte Managementmaßnahme. Wie bereits in den<br />
Schlussfolgerungen dargelegt, stellen die offenen Bereiche der Almen Rückzugsräume für alpine<br />
Arten dar, deren regionales Überleben durch klimabedingte Reduktion und Fragmentierung natürlicher<br />
alpiner Habitate gefährdet ist. Darunter befinden sich auch einige endemische Arten, die damit völlig<br />
aussterben würden.<br />
7.4.2 Management-Maßnahmen Waldwirtschaft<br />
Die waldbaulichen Maßnahmen zur Optimierung der Quellenschutz-Wirkung von Waldbeständen sind<br />
auf die ökologischen und waldhydrologischen Vorgaben (Hydrotope) und auf den vorhandenen<br />
Bestandeszustand vor Ort abzustimmen. Es können aus diesen Gründen niemals rezeptartig<br />
einsetzbare Vorgaben definiert werden, weil immer der spezifische Standort mit seinen<br />
Rahmenbedingungen zu berücksichtigen ist. Trotzdem lassen sich, im Bewusstsein dieser<br />
Grundbedingung, Management-Maßnahmen formulieren, nämlich orientiert an Zieldefinitionen<br />
(Kapitel 6.3.4) für spezifische Hydrotope und Waldgesellschaften.<br />
In allen Hydrotopen sind eine Vielzahl an Baumarten am Waldaufbau beteiligt. Neben den weit<br />
verbreiteten Baumarten wie Buche, Fichte, Tanne, Lärche, Esche oder Bergahorn gedeihen Mehlbeere,<br />
Eberesche, Bergulme, Sommer-Linde, Weiden-Arten, Schwarz-Kiefer, Rot-Kiefer und Eibe in den<br />
Wald-Beständen. Dieses vorhandene breite Baumarten-Spektrum bietet günstige Voraussetzungen, auf<br />
mögliche klimatische Veränderungen in alle Richtungen durch eine Anpassung der<br />
Baumartenverteilung elastisch zu reagieren. Alle waldbaulichen Maßnahmen sind darauf auszurichten<br />
dieses Baumartenspektrum zu erhalten und/oder zu erhöhen. Möglichst breites Baumarten-Spektrum<br />
in allen Waldbeständen sichern.<br />
Mit dem vorhandenen Verjüngungspotenzial hinsichtlich Baumarten-Zusammensetzung und<br />
Keimlingsanzahl ist eine natürliche Verjüngung der Waldbestände in zufriedenstellendem Ausmaß<br />
möglich. Für eine dem Zielwald entsprechende Jungwuchsentwicklung (Baumarten-<br />
Zusammensetzung) sind vor allem auf den Standorten des Fichten-Tannen-Buchen-Waldes und des<br />
Fichten-Tannen-Waldes die Bemühungen zur Herstellung eines waldökologisch tragfähigen<br />
Wildstandes fortzusetzen. Waldökologisch tragfähige Wildstände.<br />
Der Deckungsgrad der Waldbestände ist zur Optimierung der Quellenschutz-Wirkung permanent auf<br />
hohem Niveau zu halten. Spezifische Rahmen-Richtlinien für die diversen Hydrotop-Gruppen sind im<br />
Kapitel 6.3.4 angeführt. Permanent hoher Deckungsgrad der Waldbestände.<br />
montaner (hochmontaner) Fichten-Tannen-Buchen-Wald<br />
In Nadelbaum-dominierten Waldbeständen der Jungwuchs- und Dickungsstufe ist zur Erhaltung<br />
und/oder Verbesserung der Mischungsverhältnisse eine konsequente Mischungs-Regulierung<br />
zugunsten von Laubbaumarten und Tanne (und Lärche oder Kiefernarten auf spezifischen<br />
Hydrotopen) erforderlich. Bei rascher Umsetzung (Dringlichkeit: kurzfristig) kann die Entwicklung<br />
83