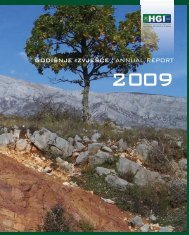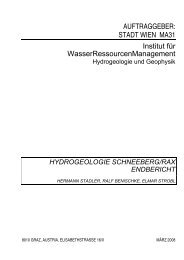Final Report - KATER
Final Report - KATER
Final Report - KATER
- TAGS
- kater
- ccwaters.eu
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Endbericht Vegetationsszenarien – Quelleneinzugsgebiete der Stadt Wien<br />
Die Humusform Moder baut sich im Zuge der Waldentwicklung auf den entsprechenden Standorten<br />
kontinuierlich auf und erreicht ab einem gewissen Stadium derselben ein dynamisches Gleichgewicht.<br />
Dieses dynamische Gleichgewicht kann durch angepasste Waldwirtschaft annähernd erhalten werden<br />
(Dauerwaldwirtschaft, Vermeidung von großflächigen Eingriffen) oder im schlechtesten Fall abrupt<br />
unterbrochen werden, was im Falle eines Kahlschlages zu einem annähernd vollständigen Abbau der<br />
Moderhumushorizonte führen würde. Kahlschlag-Bewirtschaftung ist in den Quellenschutzwäldern<br />
schon seit den Achtziger-Jahren des letzten Jahrhunderts verboten. Der bei dieser<br />
Waldbewirtschaftungs-Form auftretende Humus- und Bodenabbau vermindert einerseits das<br />
Wuchspotenzial eines Standortes, und stellt andererseits eine Quelle der Grundwasserverschmutzung<br />
durch den Eintrag von Abbauprodukten dar (Likens & Bormann 1995, Reynolds et al. 1992, v.<br />
Wilpert et al. 2000, Forti et al. 2000).<br />
Die Karten bezüglich Bodentyp, Humusform, Humusmächtigkeit und Oberflächen-Skelettanteil<br />
weisen Flächen aus, die eine besondere Grund-Disposition für eine Erosions-Gefährdung aufweisen.<br />
Aufbauend auf diesen Grundlagen können Flächen definiert werden, wo bei der Durchführung<br />
waldbaulicher Maßnahmen besondere Vorsicht geboten ist.<br />
Es sind also auch die Humus- und Bodendynamik, welche man durch Waldbewirtschaftung<br />
beeinflussen kann. Optimierung im Sinne des Quellenschutzes kann gezielt waldbauliche Maßnahmen<br />
definieren, welche beispielsweise das Auftreten von Humusabbau-Prozessen auf Hydrotopen<br />
minimieren.<br />
Daher ist die Gliederung in Waldvegetations-Charakteristika (Hydrotop B) von Bedeutung für die<br />
Definition von Management-Richtlinien für Quellenschutzwälder.<br />
Eine ausführlichere Beschreibung der Ergebnisse der bodenbezogenen Hydrotop-Kartierung findet<br />
sich in Appendix Nr.9 ‚Hydrotop-Buch’.<br />
6.3.2 Die waldvegetationsbezogene Hydrotopgliederung<br />
Die Gliederung der Teileinzugsgebiete in waldvegetationsbezogene Hydrotope schuf eine Grundlage,<br />
um waldhydrologisch ähnliche Flächen und in diesem Sinne funktionale Einheiten für hydrologische<br />
und waldbauliche Belange als Orientierungsmarken zu erhalten. Die erste Hierarchie der Gliederung<br />
bezieht sich auf die potenzielle natürliche Waldgesellschaft.<br />
Im montanen bis hochmontanen Bereich sind aktuell Fichten-Tannen-Buchen-Wald-Hydrotope<br />
flächenmäßig dominant. Ebenfalls von Bedeutung sind die Bergahorn-Eschen-(Linden)-Wald-<br />
Hydrotope. Montane Fichtenwald-Hydrotope und Sondergesellschaften sind flächenmäßig weniger<br />
bedeutend, während Felswald-Hydrotope in Teilbereichen (Fronbachgraben) von großer Bedeutung<br />
sind. Es ist zu beachten, dass hier nur eine überblicksartige Beschreibung der Hydrotope getätigt wird.<br />
Eingehend beschrieben werden sie im Hydrotop-Buch, wo auch das gesamte Baumartenspektrum,<br />
welches ein spezifisches Hydrotop zu besiedeln vermag, angeführt ist.<br />
-Fichten-Tannen-Buchen-Wald-Hydrotope: Im montanen Höhenbereich wurden vier Hydrotope dieser<br />
Kategorie ausgeschieden, wobei sich alle durch waldökologische und hydrologische<br />
Unterschiedlichkeiten voneinander abgrenzen lassen. Ein frische bis sehr frische Standorte<br />
umfassendes Hydrotop bezeichnet potenziell laubbaumreiche und laubbaumdominierte Fi-Ta-Bu-<br />
Waldbestände. Ein weiteres Hydrotop umfasst frische bis mäßig frische Standorte, die meist von<br />
nadelbaumreicheren Fi-Ta-Bu-Waldbeständen bestockt werden. Das dritte Hydrotop fasst sonnseitig<br />
exponierte, mäßig frische Standorte, welche von laubbaumreichen Fi-Ta-Bu-Beständen bestockt<br />
werden, zusammen. Das vierte Hydrotop umfasst mäßig frische bis mäßig trockene Fi-Ta-Bu-Wald-<br />
Standorte, auf denen Lärche und die beiden autochthonen Kiefernarten besser gedeihen als Fichte und<br />
Tanne, die Laubbaumarten aber auch vital und in höheren Mischungsanteilen auftreten.<br />
54