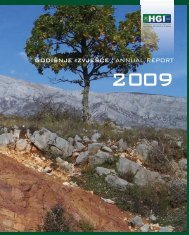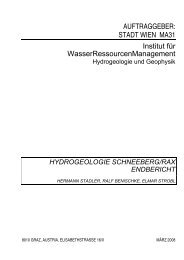Final Report - KATER
Final Report - KATER
Final Report - KATER
- TAGS
- kater
- ccwaters.eu
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Endbericht Vegetationsszenarien – Quelleneinzugsgebiete der Stadt Wien<br />
Prozess der Latschenverbrachung vor allem durch das regelmäßige Schwenden und nicht durch<br />
Verbiss kontrolliert wird.<br />
Die heutigen Almwirtschaftsgebiete liegen großteils auf potentiellen Wald- oder Latschenstandorten.<br />
Im Gegensatz zur Klimaerwärmung sind die Folgen der Almaufgabe daher großteils auf die<br />
Subalpinstufe konzentriert. Während der Klimawandel eine „kaleidoskopartige“ Verschiebung im<br />
räumlichen Verbreitungsmuster vieler Arten nach sich zieht – wenn auch für die meisten mit<br />
insgesamt negativer Bilanz – besteht die wesentliche Auswirkung der Almaufgabe in einer<br />
Homogenisierung der Vegetationsdecke. Aktuelle Mosaikbestände aus Weiderasen, Latschen (und in<br />
tieferen Lagen auch Waldinseln) werden durch großflächig geschlossene Latschengebüsche ersetzt.<br />
Die Populationen von Rasenarten verschwinden damit völlig aus dem Subalpingürtel oder werden auf<br />
natürlich gestörte Standorte wie Lawinarwiesen zurückgedrängt. Die Pflanzenartenvielfalt dieser<br />
Höhenstufe wird dadurch reduziert. Insbesondere von Gebirgsstöcken, die keinen oder nur einen<br />
geringen Anteil echt alpiner Hochlagen aufweisen (z.B. Zeller Staritzen, Schneealpe) könnten viele<br />
dieser Arten völlig verschwinden.<br />
Bezüglich der Konsequenzen für den Karstwasserhaushalt gilt prinzipiell das zu den<br />
Klimawandelfolgen gesagte. Die Latschenausbreitung, in tieferen Lagen auch die in dieser Studie<br />
nicht untersuchte natürliche Wiederbestockung aufgelassener Almflächen mit Baumarten, ist der<br />
wesentliche Prozess und seine primären Auswirkungen sind eine Erhöhung der Retentionskapazität<br />
und der Gesamtverdunstung sowie eine direkt und indirekt verbesserte Erosionsschutzwirkung der<br />
Vegetation. Der Unterschied zu den reinen Klimaerwärmungsszenarien liegt vor allem darin, dass die<br />
Latschenausbreitung im Almgürtel schneller abläuft als oberhalb der aktuellen Waldgrenze bei<br />
Klimaerwärmung. Die Ursachen dafür sind die Beschleunigung demographischer Prozesse unter den<br />
insgesamt günstigeren Standortsbedingungen der Subalpinstufe und die Tatsache, dass die heutigen<br />
Almflächen bereits stark von Latscheninseln durchsetzt sind und diese Inseln als Initialen der<br />
Latschenverbrachungsdynamik fungieren.<br />
Innerhalb des näher untersuchten Zeitrahmens von 250 Jahren sind daher die indirekten Auswirkungen<br />
der Almauflassung wesentlich massiver als die des Klimawandels. Retentionskapazität und<br />
Evapotranspiration steigen bei völliger Almauflassung um ca. 10-15% an, im Verlauf der nächsten<br />
100 Jahre immerhin um ca. 5%. Das Ausmaß dieser Veränderungen ist natürlich vom relativen<br />
Flächenverbrauch der aktuellen Almwirtschaft auf den einzelnen Gebirgsstöcken abhängig.<br />
Dementsprechend sind die Auswirkungen auf dem Hochschwab geringer als etwa auf der Schneealpe.<br />
Die Analysen haben aber auch gezeigt, dass es selbst bei Beibehaltung der Almwirtschaft und<br />
unverändertem Klima zu einer erheblichen Ausdehnung der Latschenfläche, mit den entsprechenden<br />
hydrologischen Effekten, kommt. Der Grund dafür liegt in den bis heute noch nicht abgeschlossenen<br />
Verbrachungsprozessen auf ehemaligen Almflächen und möglicherweise auch in den Auswirkungen<br />
bereits erfolgter Klimaerwärmung.<br />
Bei Latschenausbreitung in Almweiden wird außerdem der Erosionsschutz verbessert. Dieser Aspekt<br />
ist vor allem punktuell, etwa im Einzugsbereich von kleineren Dolinen, bedeutsam. Hier sind bereits<br />
relativ kurzfristig qualitative Verbesserungen der Quellschutzwirkung (z.B. Filterung von<br />
Schadstoffeintrag) zu erwarten. Nachteilig wirkt sich dagegen aus, dass die zeitliche Staffelung des<br />
Abschmelzprozesses, der die heute typischen Mosaike aus Almweiden und Latscheninseln<br />
kennzeichnet (vgl. Kapitel 5.1.1), bei einer Homogenisierung der Vegetationsdecke verloren geht.<br />
Insgesamt sind die indirekten Folgen der Almauflassung im Bereich der Hochlagen daher ähnlich<br />
ambivalent einzuschätzen wie die des Klimawandels. Aus der Perspektive des Naturschutzes<br />
überwiegen jedenfalls die negativen Konsequenzen. Aus der Perspektive des Karstquellwasserschutzes<br />
hat die Almauflassung sowohl positive als auch negative Folgen. Noch einmal sei in diesem<br />
Zusammenhang daraufhingewiesen, dass direkte Folgen der Almauflassung (z.B.: keine<br />
Erosionsbelastung durch Viehtritt, reduzierte Fäkalienbelastung des Quellwassers) nicht Gegenstand<br />
dieser Studie waren.<br />
80