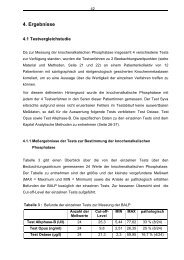Die Paarbeziehungen ungewollt kinderloser Paare und das Erleben ...
Die Paarbeziehungen ungewollt kinderloser Paare und das Erleben ...
Die Paarbeziehungen ungewollt kinderloser Paare und das Erleben ...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Partnerschaft die Meinungen bezüglich bestimmter Werte, <strong>und</strong> damit auch <strong>das</strong><br />
subjektive Ausgewogenheitsgefühl, auseinandergehen können.<br />
<strong>Die</strong> dritte These besagt, daß unausgewogene Beziehungen vom Einzelnen als<br />
unangenehm erlebt werden; <strong>und</strong> zwar fühlt man sich um so unwohler, je größer die<br />
Unausgewogenheit erlebt wird. Aus diesem Unbehagen resultiert ein Antrieb, <strong>das</strong><br />
Gleichgewicht (Equity) wiederherzustellen (These 4). <strong>Die</strong>ser Antrieb sollte um so<br />
stärker sein, je stärker die Unausgewogenheit ist. Hierbei hat nicht nur derjenige, der<br />
mehr in eine soziale Beziehung eingebracht hat (<strong>das</strong> ‘Opfer’ in der Terminologie von<br />
Walster et al.), den Wunsch, etwas mehr zu bekommen. Auch derjenige, der mehr<br />
bekommen hat als er ‘verdient’ (der ‘Ausbeuter’), hat <strong>das</strong> Bedürfnis, einen Ausgleich<br />
zu schaffen.<br />
Der Ausgleich kann real erfolgen, indem der ‘Ausbeuter’ versucht für <strong>das</strong><br />
‘Opfer’ eine Entschädigung oder ähnliches zu leisten. <strong>Die</strong> zweite Möglichkeit, diese<br />
Dissonanz zu reduzieren, ist innerpsychisch, indem der ‘Ausbeuter’ die Leistungen<br />
des ‘Opfer’ abwertet oder eigene Vorzüge aufwertet. Für welche der verschiedenen<br />
Lösungen sich der ‘Ausbeuter’ entscheidet, hängt wiederum von internen Kosten-<br />
Nutzen Überlegungen ab.<br />
1.2.2.2 <strong>Die</strong> Stimulus-Werthaltungs-Rollentheorie (SVR) der Ehepartnerwahl von<br />
Murstein<br />
<strong>Die</strong> SVR-Theorie von Murstein (1977) ist wie die Theorie von Walster et al.<br />
(1977) im wesentlichen eine austauschtheoretische Konzeption. Ein wichtiger<br />
Unterschied besteht allerdings darin, daß der Autor annimmt, ein Mensch fühle sich<br />
dann am wohlsten, wenn sein Partner möglichst viele <strong>und</strong> durchaus mehr positive<br />
Eigenschaften als er selbst auf sich vereine. Hierbei werden z.B. beim Kennenlernen<br />
eines möglichen Partners verschiedene Aspekte verrechnet: neben den positiven<br />
<strong>und</strong> negativen Eigenschaften dieses Menschen bestimmen ebenso die<br />
phantasierten Kosten für eine Zurückweisung oder die Freude über eine Zusage <strong>das</strong><br />
Ergebnis der Überlegungen. Stellt sich nach einer Partnerwahl heraus, daß man<br />
sich getäuscht <strong>und</strong> der Partner mehr negative Eigenschaften hat als gedacht, fällt<br />
die Entscheidung für oder gegen eine Trennung in Abhängigkeit von den vermuteten<br />
Kosten einer Trennung oder wahrgenommenen Alternativen, aber auch von<br />
Faktoren wie dem eigenen Selbstbild <strong>und</strong> Selbstideal. „Zusammenfassend kann<br />
gesagt werden, daß dem Austausch während der Suche nach einem Ehepartner<br />
große Bedeutung zukommt, daß er aber für die Aufrechterhaltung einer<br />
langdauernden Verlobung oder Ehe etwas weniger wichtig ist, obwohl ihm auch hier<br />
noch ein beträchtliches Gewicht zukommt.“ (Murstein, 1977, S.172). Weiterhin stellt<br />
der Autor drei Phasen einer Beziehung dar, die durch verschiedene<br />
- 7 -