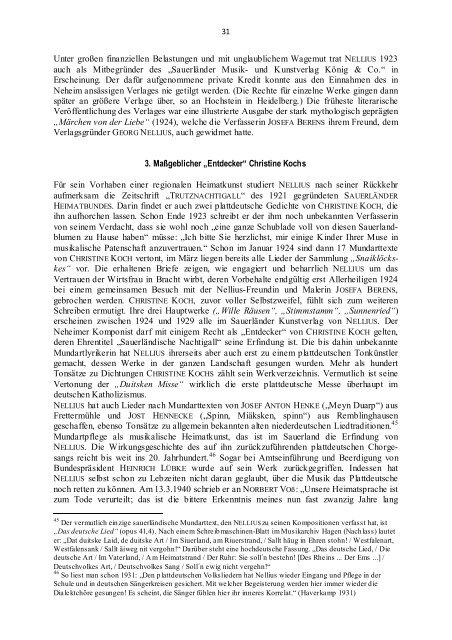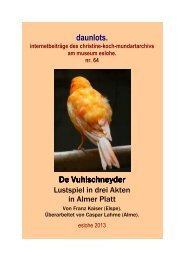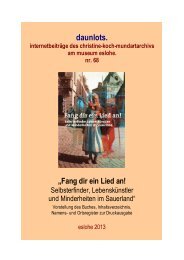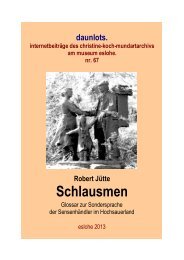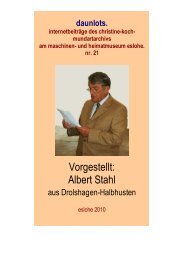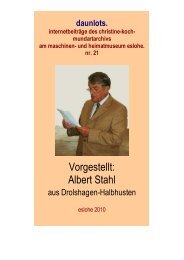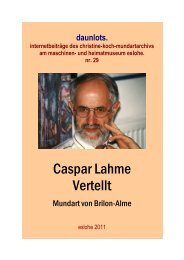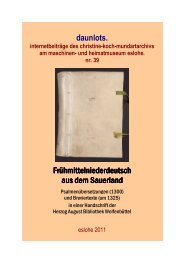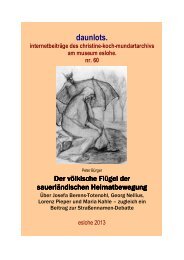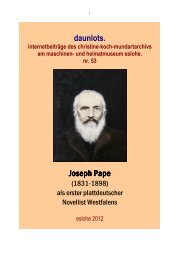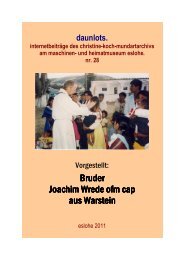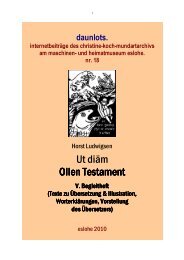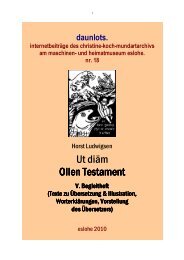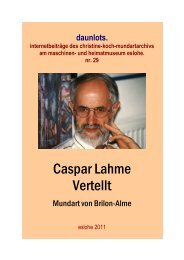daunlots 60 - Sauerlandmundart
daunlots 60 - Sauerlandmundart
daunlots 60 - Sauerlandmundart
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
31<br />
Unter großen finanziellen Belastungen und mit unglaublichem Wagemut trat NELLIUS 1923<br />
auch als Mitbegründer des „Sauerländer Musik- und Kunstverlag König & Co.“ in<br />
Erscheinung. Der dafür aufgenommene private Kredit konnte aus den Einnahmen des in<br />
Neheim ansässigen Verlages nie getilgt werden. (Die Rechte für einzelne Werke gingen dann<br />
später an größere Verlage über, so an Hochstein in Heidelberg.) Die früheste literarische<br />
Veröffentlichung des Verlages war eine illustrierte Ausgabe der stark mythologisch geprägten<br />
„Märchen von der Liebe“ (1924), welche die Verfasserin JOSEFA BERENS ihrem Freund, dem<br />
Verlagsgründer GEORG NELLIUS, auch gewidmet hatte.<br />
3. Maßgeblicher „Entdecker“ Christine Kochs<br />
Für sein Vorhaben einer regionalen Heimatkunst studiert NELLIUS nach seiner Rückkehr<br />
aufmerksam die Zeitschrift „TRUTZNACHTIGALL“ des 1921 gegründeten SAUERLÄNDER<br />
HEIMATBUNDES. Darin findet er auch zwei plattdeutsche Gedichte von CHRISTINE KOCH, die<br />
ihn aufhorchen lassen. Schon Ende 1923 schreibt er der ihm noch unbekannten Verfasserin<br />
von seinem Verdacht, dass sie wohl noch „eine ganze Schublade voll von diesen Sauerlandblumen<br />
zu Hause haben“ müsse: „Ich bitte Sie herzlichst, mir einige Kinder Ihrer Muse in<br />
musikalische Patenschaft anzuvertrauen.“ Schon im Januar 1924 sind dann 17 Mundarttexte<br />
von CHRISTINE KOCH vertont, im März liegen bereits alle Lieder der Sammlung „Snaiklöckskes“<br />
vor. Die erhaltenen Briefe zeigen, wie engagiert und beharrlich NELLIUS um das<br />
Vertrauen der Wirtsfrau in Bracht wirbt, deren Vorbehalte endgültig erst Allerheiligen 1924<br />
bei einem gemeinsamen Besuch mit der Nellius-Freundin und Malerin JOSEFA BERENS,<br />
gebrochen werden. CHRISTINE KOCH, zuvor voller Selbstzweifel, fühlt sich zum weiteren<br />
Schreiben ermutigt. Ihre drei Hauptwerke („Wille Räusen“, „Stimmstamm“, „Sunnenried“)<br />
erscheinen zwischen 1924 und 1929 alle im Sauerländer Kunstverlag von NELLIUS. Der<br />
Neheimer Komponist darf mit einigem Recht als „Entdecker“ von CHRISTINE KOCH gelten,<br />
deren Ehrentitel „Sauerländische Nachtigall“ seine Erfindung ist. Die bis dahin unbekannte<br />
Mundartlyrikerin hat NELLIUS ihrerseits aber auch erst zu einem plattdeutschen Tonkünstler<br />
gemacht, dessen Werke in der ganzen Landschaft gesungen wurden. Mehr als hundert<br />
Tonsätze zu Dichtungen CHRISTINE KOCHS zählt sein Werkverzeichnis. Vermutlich ist seine<br />
Vertonung der „Duitsken Misse“ wirklich die erste plattdeutsche Messe überhaupt im<br />
deutschen Katholizismus.<br />
NELLIUS hat auch Lieder nach Mundarttexten von JOSEF ANTON HENKE („Meyn Duarp“) aus<br />
Frettermühle und JOST HENNECKE („Spinn, Miäksken, spinn“) aus Remblinghausen<br />
geschaffen, ebenso Tonsätze zu allgemein bekannten alten niederdeutschen Liedtraditionen. 45<br />
Mundartpflege als musikalische Heimatkunst, das ist im Sauerland die Erfindung von<br />
NELLIUS. Die Wirkungsgeschichte des auf ihn zurückzuführenden plattdeutschen Chorgesangs<br />
reicht bis weit ins 20. Jahrhundert. 46 Sogar bei Amtseinführung und Beerdigung von<br />
Bundespräsident HEINRICH LÜBKE wurde auf sein Werk zurückgegriffen. Indessen hat<br />
NELLIUS selbst schon zu Lebzeiten nicht daran geglaubt, über die Musik das Plattdeutsche<br />
noch retten zu können. Am 13.3.1940 schrieb er an NORBERT VOß: „Unsere Heimatsprache ist<br />
zum Tode verurteilt; das ist die bittere Erkenntnis meines nun fast zwanzig Jahre lang<br />
45 Der vermutlich einzige sauerländische Mundarttext, den NELLIUS zu seinen Kompositionen verfasst hat, ist<br />
„Das deutsche Lied“ (opus 41,4). Nach einem Schreibmaschinen-Blatt im Musikarchiv Hagen (Nachlass) lautet<br />
er: „Dat duitske Laid, de duitske Art / Im Siuerland, am Riuerstrand, / Sallt häug in Ehren stohn! / Westfalenart,<br />
Westfalensank / Sallt äiweg nit vergohn!“ Darüber steht eine hochdeutsche Fassung. „Das deutsche Lied, / Die<br />
deutsche Art / Im Vaterland, / A m Heimatstrand / Der Ruhr: Sie soll´n bestehn! [Des Rheins ... Der Ems ...] /<br />
Deutschvolkes Art, / Deutschvolkes Sang / Soll´n ewig nicht vergehn!“<br />
46 So liest man schon 1931: „Den plattdeutschen Volksliedern hat Nellius wieder Eingang und Pflege in der<br />
Schule und in deutschen Sängerkreisen gesichert. Mit welcher Begeisterung werden hier immer wieder die<br />
Dialektchöre gesungen! Es scheint, die Sänger fühlen hier ihr inneres Korrelat.“ (Haverkamp 1931)