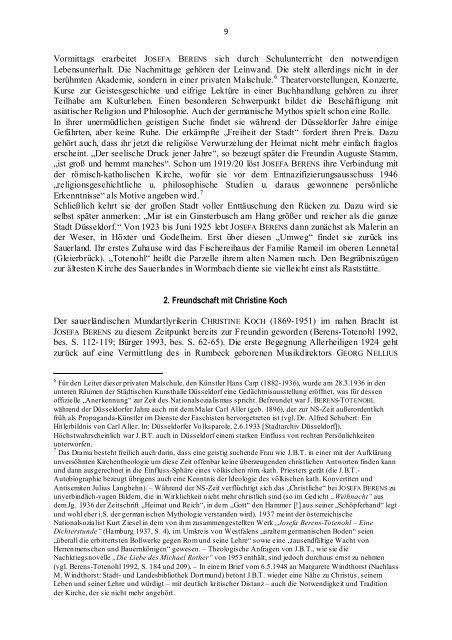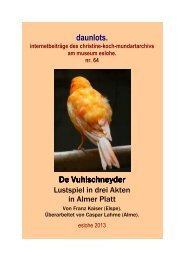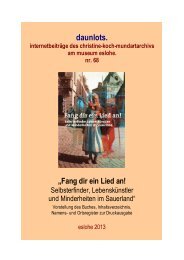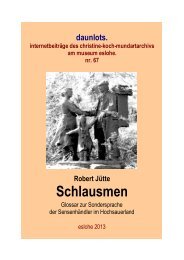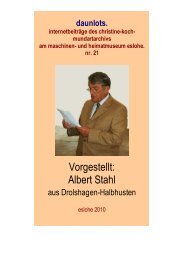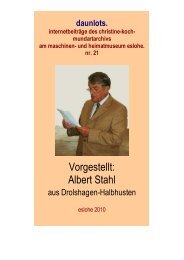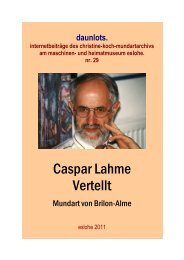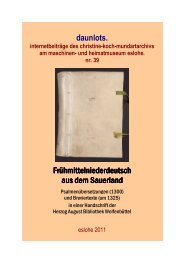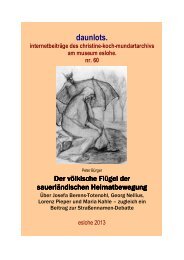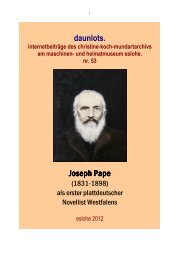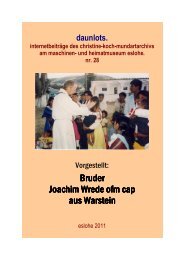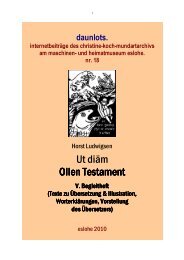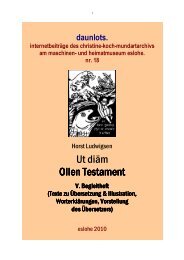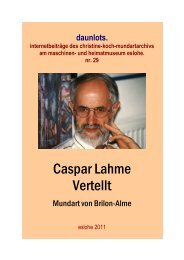daunlots 60 - Sauerlandmundart
daunlots 60 - Sauerlandmundart
daunlots 60 - Sauerlandmundart
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
9<br />
Vormittags erarbeitet JOSEFA BERENS sich durch Schulunterricht den notwendigen<br />
Lebensunterhalt. Die Nachmittage gehören der Leinwand. Die steht allerdings nicht in der<br />
berühmten Akademie, sondern in einer privaten Malschule. 6 Theatervorstellungen, Konzerte,<br />
Kurse zur Geistesgeschichte und eifrige Lektüre in einer Buchhandlung gehören zu ihrer<br />
Teilhabe am Kulturleben. Einen besonderen Schwerpunkt bildet die Beschäftigung mit<br />
asiatischer Religion und Philosophie. Auch der germanische Mythos spielt schon eine Rolle.<br />
In ihrer unermüdlichen geistigen Suche findet sie während der Düsseldorfer Jahre einige<br />
Gefährten, aber keine Ruhe. Die erkämpfte „Freiheit der Stadt“ fordert ihren Preis. Dazu<br />
gehört auch, dass ihr jetzt die religiöse Verwurzelung der Heimat nicht mehr einfach fraglos<br />
erscheint. „Der seelische Druck jener Jahre“, so bezeugt später die Freundin Auguste Stamm,<br />
„ist groß und hemmt manches“. Schon um 1919/20 löst JOSEFA BERENS ihre Verbindung mit<br />
der römisch-katholischen Kirche, wofür sie vor dem Entnazifizierungsausschuss 1946<br />
„religionsgeschichtliche u. philosophische Studien u. daraus gewonnene persönliche<br />
Erkenntnisse“ als Motive angeben wird. 7<br />
Schließlich kehrt sie der großen Stadt voller Enttäuschung den Rücken zu. Dazu wird sie<br />
selbst später anmerken: „Mir ist ein Ginsterbusch am Hang größer und reicher als die ganze<br />
Stadt Düsseldorf.“ Von 1923 bis Juni 1925 lebt JOSEFA BERENS dann zunächst als Malerin an<br />
der Weser, in Höxter und Godelheim. Erst über diesen „Umweg“ findet sie zurück ins<br />
Sauerland. Ihr erstes Zuhause wird das Fischereihaus der Familie Rameil im oberen Lennetal<br />
(Gleierbrück). „Totenohl“ heißt die Parzelle ihrem alten Namen nach. Den Begräbniszügen<br />
zur ältesten Kirche des Sauerlandes in Wormbach diente sie vielleicht einst als Raststätte.<br />
2. Freundschaft mit Christine Koch<br />
Der sauerländischen Mundartlyrikerin CHRISTINE KOCH (1869-1951) im nahen Bracht ist<br />
JOSEFA BERENS zu diesem Zeitpunkt bereits zur Freundin geworden (Berens-Totenohl 1992,<br />
bes. S. 112-119; Bürger 1993, bes. S. 62-65). Die erste Begegnung Allerheiligen 1924 geht<br />
zurück auf eine Vermittlung des in Rumbeck geborenen Musikdirektors GEORG NELLIUS<br />
6 Für den Leiter dieser privaten Malschule, den Künstler Hans Carp (1882-1936), wurde am 28.3.1936 in den<br />
unteren Räumen der Städtischen Kunsthalle Düsseldorf eine Gedächtnisausstellung eröffnet, was für dessen<br />
offizielle „Anerkennung“ zur Zeit des Nationalsozialis mus spricht. Befreundet war J. BERENS-TOTENOHL<br />
während der Düsseldorfer Jahre auch mit dem Maler Carl Aller (geb. 1896), der zur NS-Zeit außerordentlich<br />
früh als Propaganda-Künstler im Dienste der Faschisten hervorgetreten ist (vgl. Dr. Alfred Schubert: Ein<br />
Hitlerbildnis von Carl A ller. In: Düsseldorfer Volksparole, 2.6.1933 [Stadtarchiv Düsseldorf]).<br />
Höchstwahrscheinlich war J.B.T. auch in Düsseldorf einem starken Einfluss von rechten Persönlichkeiten<br />
unterworfen.<br />
7 Das Drama besteht freilich auch darin, dass eine geistig suchende Frau wie J.B.T. in einer mit der Aufklärung<br />
unversöhnten Kirchentheologie um diese Zeit offenbar keine überzeugenden christlichen Antworten finden kann<br />
und dann ausgerechnet in die Einfluss-Sphäre eines völkischen röm.-kath. Priesters gerät (die J.B.T.-<br />
Autobiographie bezeugt übrigens auch eine Kenntnis der Ideologie des völkischen kath. Konvertiten und<br />
Antisemiten Julius Langbehn). – Während der NS-Zeit verflüchtigt sich das „Christliche“ bei JOSEFA BERENS zu<br />
unverbindlich-vagen Bildern, die in Wirklichkeit nicht mehr christlich sind (so im Gedicht „Weihnacht“ aus<br />
dem Jg. 1936 der Zeitschrift „Heimat und Reich“, in dem „Gott“ den Hammer [!] aus seiner „Schöpferhand“ legt<br />
und wohl eher i.S. der germanischen Mythologie verstanden wird). 1937 meint der österreichische<br />
Nationalsozialist Kurt Ziesel in dem von ihm zusammengestellten Werk „Josefa Berens-Totenohl – Eine<br />
Dichterstunde“ (Hamburg 1937, S. 4), im Umkreis von Westfalens „uraltem germanischen Boden“ seien<br />
„überall die erbittertsten Bollwerke gegen Rom und seine Lehre“ sowie eine „tausendfältige Wacht von<br />
Herrenmenschen und Bauernkönigen“ gewesen. – Theologische Anfragen von J.B.T., wie sie die<br />
Nachkriegsnovelle „Die Liebe des Michael Rother“ von 1953 enthält, sind jedoch durchaus ernst zu nehmen<br />
(vgl. Berens-Totenohl 1992, S. 184 und 209). – In einem Brief vom 6.5.1948 an Margarete Windthorst (Nachlass<br />
M. Windthorst: Stadt- und Landesbibliothek Dortmund) betont J.B.T. wieder eine Nähe zu Christus, seinem<br />
Leben und seiner Lehre und würdigt – mit deutlich kritischer Distanz – auch die Notwendigkeit und Tradition<br />
der Kirche, der sie nicht mehr angehört.