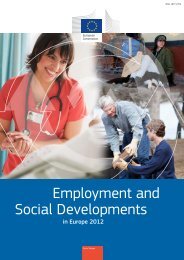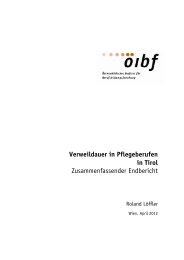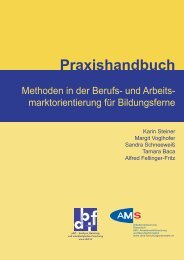(PDF) Armutslagen in Wien - Statistik Austria
(PDF) Armutslagen in Wien - Statistik Austria
(PDF) Armutslagen in Wien - Statistik Austria
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Migrantische <strong>Armutslagen</strong><br />
E<strong>in</strong>leitung und Fragestellungen<br />
Migrantische <strong>Armutslagen</strong><br />
Anne Unterwurzacher<br />
Laut den Ergebnissen der EU-SILC Erhebung von 2003 lebt <strong>in</strong> Österreich über e<strong>in</strong> Viertel<br />
28<br />
der MigrantInnen <strong>in</strong> Armutsgefährdung (<strong>Statistik</strong> <strong>Austria</strong>, 2005, S. 31). Zusätzlich zur<br />
E<strong>in</strong>kommensarmut s<strong>in</strong>d MigrantInnen auch <strong>in</strong> anderen Lebensbereichen von Ausgrenzung<br />
und mangelnden Teilhabechancen betroffen. Zur Analyse monetärer und nicht-monetärer<br />
Armut wird <strong>in</strong> Anlehnung an die deutsche Armutsberichterstattung auf das Konzept der<br />
Lebenslage zurückgegriffen (Voges et. al, 2003). Unter Bezugnahme auf dieses zentrale<br />
Konzept werden neben materiellen Problemlagen mögliche Defizite bzw. Unterversorgungslagen<br />
<strong>in</strong> zentralen Lebensbereichen wie etwa Schule, Erwerbstätigkeit, Wohnen<br />
und Gesundheit analysiert. Für diesen Zweck werden die bestehenden Datenquellen (EU-<br />
SILC 2003, LLIW II 2003) für e<strong>in</strong>e Untersuchung migrationsspezifischer Lebenslagen<br />
nutzbar gemacht.<br />
Im H<strong>in</strong>blick auf die Lebenslagen von MigrantInnen s<strong>in</strong>d die gesellschaftlich gewährten<br />
Teilhabechancen von besonderer Bedeutung. Die rechtlichen Rahmenbed<strong>in</strong>gungen setzen<br />
die Grenze, <strong>in</strong>nerhalb derer die gesellschaftliche Teilhabe von ausländischen StaatsbürgerInnen<br />
möglich ist. Schwellen des Ausschlusses ergeben sich vor allem aus dem<br />
ausländerrechtlichen Aufenthaltsstatus. Neben mangelnden politischen Teilhabemöglichkeiten<br />
ist auch der Zugang zum Arbeitsmarkt und zum System der sozialen Sicherung an<br />
den E<strong>in</strong>bürgerungsstatus bzw. an die Aufenthaltsdauer (z.B. Sozialhilfebezug <strong>in</strong> <strong>Wien</strong>)<br />
gebunden. Der empirische Befund, dass ausländische StaatsbügerInnen besonders armutsgefährdet<br />
s<strong>in</strong>d, lässt auch die Novelle des Staatsbürgerschaftsrechts 2005 problematisch<br />
ersche<strong>in</strong>en: Bei Bezug von Notstands- oder Sozialhilfe <strong>in</strong>nerhalb der letzten drei Jahre bleibt<br />
ausländischen StaatsbürgerInnen die österreichische Staatsbürgerschaft verwehrt. Das<br />
österreichische Staatsbürgerschaftsrecht zieht also e<strong>in</strong>e scharfe Trennl<strong>in</strong>ie zwischen Zugewanderten<br />
und E<strong>in</strong>heimischen. Bei der Frage nach der Teilhabe oder Ausgrenzung von<br />
MigrantInnen ist daher immer zu berücksichtigen, dass sich die Lebenslagen von nichte<strong>in</strong>gebürgerten<br />
MigrantInnen und E<strong>in</strong>heimischen nicht so ohne weiteres mite<strong>in</strong>ander<br />
vergleichen lassen, da staatliche Institutionen über rechtliche Regelungen unterschiedliche<br />
„Versorgungslagen“ wesentlich mit bee<strong>in</strong>flussen (können). Ob staatliche Institutionen wie<br />
es Bremer (1999, S. 16) ausdrückt „Ausgrenzung <strong>in</strong> unterschiedlichen Lebensbereichen<br />
kompensieren vermögen, oder ob sie diese erst hervorrufen“ wird je nach gesellschaftlichem<br />
Mitgliedsstatus anders zu beantworten se<strong>in</strong>.<br />
Neben den gesellschaftlichen Bestimmungsgründen, die ke<strong>in</strong> weiterer Gegenstand der<br />
Analyse se<strong>in</strong> werden, gehen <strong>in</strong> Anlehnung an die <strong>in</strong>ternationale Forschung folgende <strong>in</strong>dividuelle<br />
Lebenslagendimensionen <strong>in</strong> die empirische Analyse e<strong>in</strong>: Erwerbstätigkeit,<br />
Bildung, E<strong>in</strong>kommen, Wohnen und Gesundheit. Die Zielsetzung des empirischen Teils des<br />
Berichtes lässt sich <strong>in</strong> folgende Detailfragestellung ausdifferenzieren:<br />
28<br />
In den auf den EU-SILC Erhebungen basierenden Berichten über „E<strong>in</strong>kommen, Armut und Lebensbed<strong>in</strong>gungen“ werden<br />
MigrantInnen als Personen mit e<strong>in</strong>er anderen als der österreichischen, EU- oder EFTA-Staatsbürgerschaft bezeichnet.<br />
87