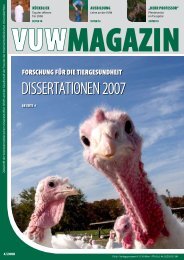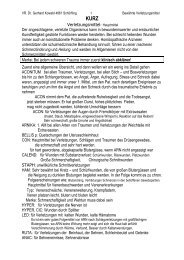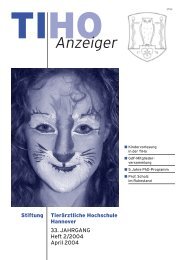Band 13/14 - VET-MAGAZIN.com
Band 13/14 - VET-MAGAZIN.com
Band 13/14 - VET-MAGAZIN.com
- Keine Tags gefunden...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
(2589) Kuhn, J. & Rohrbach, Th. (1998): Beobachtungen zur Fortpflanzungsbiologiedes Springfroschs (Rana dalmatina).- Herpetofauna 20(112): 26-24.Es werden einige Beobachtungen zur Fortpflanzungsbiologie des Springfroschs(Rana dalmatina) mitgeteilt welche die bisherigen Kenntnisseergänzen, relativieren und abrunden. Die Beobachtungen stammen ausder Verbreitungsinsel im westlichen Bodenseeraum. Folgende Aspektewerden behandelt: Jahres- und tageszeitliche Phänologie der Wanderungzum Laichgewässer und der Laichzeit, Dauer des Wasseraufenthalts,Rückwanderung in die Sommerlebensräume, Umfärbung im Wasser,Paarungs- und Laichbereitschaft, Verhalten lockrufender Männchen, Verpaarung,Kämpfe der Männchen um die Weibchen, Laichverhalten undDauer des Amplexus.[Zusammenfassung](2590) Kuhn, J. & Schmidt-Sibeth, J. (1998): Zur Biologie und Populationsökologiedes Springfrosches (Rana dalmatina): Langzeitbeobachtungenaus Oberbayern.- Zeitschrift für Feldherpetologie 5: 115-<strong>13</strong>7.(Max-Planck-Institut für Verhaltensphysiologie, Abt. Wickler, D-82319 Seewiesen;Schweinfurter Str. 10b, D-81243 München)Die Arbeit wertet langjährige Beobachtungen an der Springfroschpopulationeines Laichgewässerkomplexes im oberbayerischen Alpenvorlandaus. Die Entwicklung der Laichbestände 1986-1998 und die Phänologieder Laichzeiten 1984-1998 werden dargestellt und einige Beobachtungenzu Mortalitätsfaktoren mitgeteilt. Die starken Bestandsschwankungen lassensich primär auf Witterungsfaktoren zurückführen: Die Laichbeständekorrelieren eng mit den Temperaturverhältnissen während der jeweilsdrei Jahre zurückliegenden aquatischen Entwicklungsphase. Die Witterungsverläufeder Spätwinter und Frühlinge dürften demnach vonherausragender Bedeutung für lokale Bestandsschwankungen, für natürlichelokale Aussterbe- und Wiederbesiedlungsvorgänge sowie für dasüberregionale Verbreitungsbild des Springfrosches sein. Als Landhabitatenutzt die Population Fichtenforste. Für die nächtliche Sommer- undHerbstaktivität liegt die Mindesttemperatur am Boden bei 10,5°C; stärkereAktivität setzt erst ab <strong>13</strong>-<strong>14</strong>°C ein. Nur bei Temperaturen nah derunteren Schwelle scheint Regen die Aktivität erkennbar zu fördern, beihöheren Temperaturen reicht schon schwache Feuchte. Im Oktober wurdeein Männchen bei < 6°C gefangen. Weitere phänologische Beobachtungenbetreffen u. a. den saisonalen Beginn von Laichansatz undSchwielenpigmentierung. Körperlängen und Massen werden mit andereneuropäischen Populationen verglichen. Die Beziehungen zwischenSpring- und Grasfrosch (Rana temporaria) werden kurz diskutiert (Laichfressen,Fehlpaarungen).[Zusammenfassung](2591) Kuhn, J. (1998): Life-history-Analysen, Verhaltens- und Populationsökologieim Naturschutz: die Notwendigkeit von Langzeitstudien.-Schriftenreihe Landschaftspflege und Naturschutz 58: 93-1<strong>13</strong>.74