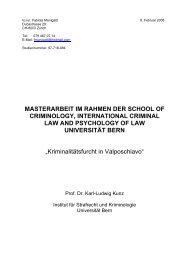Ausgewählte Abgrenzungsprobleme bei kriminellen und ...
Ausgewählte Abgrenzungsprobleme bei kriminellen und ...
Ausgewählte Abgrenzungsprobleme bei kriminellen und ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Kriminelle <strong>und</strong> terroristische Organisationen<br />
Verhalten verb<strong>und</strong>ene Verschwiegenheit genügt nicht. Erforderlich ist eine qualifizierte <strong>und</strong><br />
systematische Verheimlichung, die sich nicht notwendig auf das Bestehen der Organisation<br />
selbst, wohl aber auf deren interne Struktur sowie den Kreis ihrer Mitglieder <strong>und</strong> Helfer<br />
erstrecken muss. Zudem muss die Organisation den Zweck verfolgen, Gewaltverbrechen zu<br />
begehen oder sich durch verbrecherische Mittel Einkünfte zu verschaffen. Die Bereicherung<br />
durch verbrecherische Mittel setzt das Bestreben der Organisation voraus, sich durch die<br />
Begehung von Verbrechen, namentlich von Verbrechen gegen das Vermögen <strong>und</strong> von als<br />
Verbrechen erfassten Widerhandlungen gegen das Betäubungsmittelgesetz, rechtswidrige<br />
Vermögensvorteile zu verschaffen.“ 24<br />
2.4. Schlussfolgerungen <strong>und</strong> Empfehlungen<br />
Der Begriff organisierte Kriminalität umschreibt ein Phänomen <strong>und</strong> mag für kriminologische<br />
<strong>und</strong> kriminalpolitische Überlegungen dienlich sein. Das Konzept der organisierten Kriminalität<br />
ist eine kriminalpolitisch motivierte Begriffsschöpfung, die aufgr<strong>und</strong> des Fehlens bisheriger<br />
strafrechtlicher Zugriffsmöglichkeiten geschaffen wurde. Es wird eine bildhafte, gleichsam<br />
allegorische Begrifflichkeit („Organisation“) verwendet, deren Bedeutungsgehalt nicht<br />
exakt <strong>und</strong> abschliessend bestimmt, sondern nur exemplarisch <strong>und</strong> analogisch erschlossen<br />
werden kann. 25 Für juristisch-dogmatische Abgrenzungen oder gar Straftatbestandsumschreibungen<br />
ist der Begriff jedoch nicht geeignet. Zu oft <strong>und</strong> irreführend wird OK wie ein Rechtsbegriff<br />
verwendet, obwohl er nirgends definiert ist. Spätestens im Gerichtssaal ist der Begriff<br />
der OK „unpraktikabler Prozessstoff“, 26 weshalb er in diesem Zusammenhang keine Erwähnung<br />
finden sollte.<br />
Auch der Begriff des organisierten Verbrechens, verstanden als Konzept, bringt keinen definitorischen<br />
Mehrwert: Er steht nicht nur für eine unbestimmte Anzahl möglicher Straftaten,<br />
sondern auch für eine Vielzahl graduell abgestufter Vernetzungsformen von Straftätern (krimineller<br />
Organisationen, Banden etc.), sei es regional, national oder international. 27 Die B<strong>und</strong>eszuständigkeitsnorm<br />
von Art. 337 Abs. 1 StGB bzw. die darin erwähnten Straftatbestände<br />
lassen immerhin die Annahme eines juristischen Oberbegriffes zu. Weiter kommt hinzu, dass<br />
die vom Gesetzgeber gewählte, offene Formulierung „Verbrechen, die von einer <strong>kriminellen</strong><br />
Organisation im Sinne von Art. 260ter StGB ausgehen“ Raum lässt für weitere Verbrechensstraftatbestände<br />
des Besonderen Teils des StGB, aber auch der Nebenstrafgesetzgebung (namentlich<br />
qualifizierte Widerhandlungen gegen das Betäubungsmittelgesetz im Sinne von Art.<br />
19 Ziff. 2 BetmG), die in Beziehung zum organisierten Verbrechen stehen.<br />
Die Begriffe OK <strong>und</strong> organisiertes Verbrechens können für Polizeiorganigramme <strong>und</strong> als<br />
Kurzumschreibung eines Phänomens mehrerer Deliktskategorien hilfreich sein, aufgr<strong>und</strong> ih-<br />
24<br />
BGE 132 IV 132 E. 4.1.1.; siehe auch BGE 129 IV 271, 273 f. E. 2.3.1 (publiziert in Pra 2004 Nr. 89, 511<br />
f.); Urteil des B<strong>und</strong>esgerichts 6S.463/1996 vom 27.08.1996, E. 4 (veröffentlicht in SJ 1997, 1 ff.); BBl 1993<br />
297 ff.; NATTERER, Landesbericht, 740 ff.<br />
25<br />
KUNZ, plädoyer 1996, 33; MÖHN, OK-Begriff, 534.<br />
26<br />
FALK, Analyse der OK, 17.<br />
27<br />
PIETH/FREIBURGHAUS, Bericht EJPD 1993, 15.<br />
7