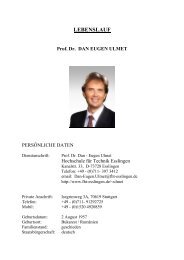Elektrische Maschinen Teil: 1 u. 2
Elektrische Maschinen Teil: 1 u. 2
Elektrische Maschinen Teil: 1 u. 2
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Prof. Dr.-Ing. E. Nolle 2-17<br />
<strong>Elektrische</strong> <strong>Maschinen</strong><br />
Dabei gilt mit dem Leistungsbeitrag Sv des Einzeltransformators<br />
uk<br />
min<br />
Sges<br />
max = ∑ ⋅ SNν<br />
≤ ∑SNν<br />
u<br />
S<br />
S<br />
ν<br />
Nν<br />
S<br />
=<br />
S<br />
ν kν<br />
ν<br />
ges<br />
ges max<br />
u<br />
⋅<br />
u<br />
k min<br />
kν<br />
≤ 1<br />
und für die resultierende Kurzschlussspannung der Parallelschaltung<br />
S ges<br />
uk = ⋅u<br />
k min ≤ uk<br />
min .<br />
S ges max<br />
Aber auch bei gleichen Kurzschlussspannungen jedoch unterschiedlichen Kurzschlussleistungsfaktoren<br />
ergibt sich als Folge der vektoriellen Stromaddition eine Minderausnutzung der Parallelschaltung.<br />
U 1<br />
Bild 2.17 Gesamtstrom bei unterschiedlichem cos ϕk der Transformatoren<br />
Für u1k ≠ u2k und φ1k ≠ φ2k überlagern sich beide Effekte, d. h. die tatsächliche Leistung der<br />
Parallelschaltung reduziert sich noch weiter gegenüber der rechnerischen Summenleistung.<br />
2.6.2 Spartransformatoren<br />
Oftmals muss eine Versorgungsspannung geändert werden, ohne dass gleichzeitig eine galvanische<br />
Trennung erforderlich ist. Dies lässt sich vorteilhaft mit sog. Spartransformatoren erreichen, bei denen<br />
stets eine Wicklung, z. B. nach Bild 2.18 die Unterspannungswicklung, für die Primär- oder<br />
Sekundärwicklung gemeinsam genutzt wird.<br />
Dabei können Spartransformatoren sowohl als Einphasen- oder auch als Drehstromtransformatoren<br />
gebaut werden. Bei symmetrischer Belastung genügt wieder die Untersuchung der einphasigen<br />
Ersatzschaltung.<br />
Vereinfachend geht man hier von einem verlustlosen Transformator aus, wobei sich dann folgende<br />
grundlegenden Zusammenhänge ergeben:<br />
N<br />
P<br />
S<br />
I<br />
D<br />
I<br />
1<br />
P<br />
= U<br />
= I<br />
U<br />
2<br />
1<br />
= N<br />
R 1k<br />
I<br />
1<br />
+ I<br />
R<br />
I<br />
= U<br />
2<br />
P<br />
I 1<br />
I 2<br />
2<br />
I<br />
2<br />
X 1k<br />
R 2k X 2k U 2<br />
I<br />
jIm 0<br />
Durchgangsleistung<br />
Knotenpunktsgleichung<br />
Durchflutungsgleichgewicht<br />
U1<br />
S B = ( U 2 −U<br />
1)<br />
I 2 = S D ( 1−<br />
) Bauleistung<br />
U 2<br />
Interessant ist dabei, dass die Bauleistung des Spartransformators, das ist die Leistung die per<br />
Magnetfeld übertragen und für die er somit ausgelegt werden muss, umso kleiner ist, je mehr sich die<br />
Primär- und Sekundärspannungen annähern. Spartransformatoren sind also bei kleinen<br />
Spannungsunterschieden besonders vorteilhaft.<br />
Nachteilig bei Spartransformatoren sind<br />
- die fehlende galvanische Trennung,<br />
- die zusätzlich verkleinerte Kurzschlussspannung<br />
Re<br />
U<br />
ϕ 1k<br />
ϕ 2k<br />
jX 2k I 2<br />
R 2k I 2<br />
I 2<br />
I 1<br />
I