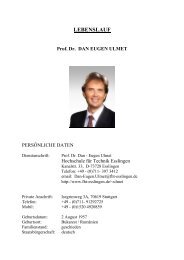Elektrische Maschinen Teil: 1 u. 2
Elektrische Maschinen Teil: 1 u. 2
Elektrische Maschinen Teil: 1 u. 2
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Prof. Dr.-Ing. Eugen 3-18<br />
<strong>Elektrische</strong> <strong>Maschinen</strong><br />
Aus diesen Gründen ist die zulässige Spannungstoleranz bei Asynchronmaschinen gegenüber den<br />
sonst üblichen Toleranzen auf + 5 % eingeengt. Soll die Maschine für einen größeren Spannungsbereich<br />
einsetzbar sein, so ist dies bei der Auslegung explizit zu berücksichtigen und z. B. auf dem Typenschild<br />
anzugeben.<br />
3.4.5 Betrieb am Umrichter<br />
Drehzahlvariable Anwendungen blieben den robusten und zuverlässigen Asynchronmaschinen lange<br />
verschlossen, da sie am öffentlichen Netz nur in engen, durch die Polzahl grob gestuften,<br />
Drehzahlbereichen arbeiten können. Nur in Sonderfällen war eine Drehzahlverstellung möglich, so z. B.<br />
durch<br />
- Schlupfverstellung beim Schleifringläufermotor, wodurch allerdings der größte Vorteil<br />
„Betriebssicherheit“ aufgegeben werden musste und auch der Wirkungsgrad litt, bzw.<br />
- Spannungssteuerung in Verbindung mit stark drehzahlabhängigen Lastkennlinien (Änderung des<br />
Nebenschlussverhaltens).<br />
Erst durch die moderne Leistungselektronik ist es möglich, Asynchronmaschinen an einem künstlichen<br />
frequenz- und spannungsvariablen Netz mit hervorragenden dynamischen Eigenschaften zu betreiben.<br />
3.4.5.1 Frequenzumrichter<br />
Moderne Frequenzumrichter sind meistens entsprechend Bild 3.16 aufgebaut.<br />
L1<br />
L2<br />
L3<br />
öffentl. Netz<br />
f, U = const<br />
Gleichrichter<br />
U DC<br />
Bild 3.16 Konzept moderner Frequenzumrichter<br />
Danach entnehmen sie dem öffentlichen Versorgungsnetz elektrische Energie bei konstanter Spannung<br />
und Frequenz und wandeln diese mit Gleichrichtern zunächst in eine ggf. variable Gleichspannung um.<br />
Aus dieser wird dann im Wechselrichter gemäß Bild 3.17 ein Spannungspulsmuster erzeugt, das<br />
meistens bei konstanter Pulsfrequenz im kHz-Bereich und Variation (Modulation) der Pulsbreite eine<br />
dominierende Grundwelle gewünschter Frequenz und Amplitude enthält. Man spricht daher auch von<br />
Pulsbreiten- bzw. Pulsweitenmodulation (PWM).<br />
Bild 3.17 Spannungs- und Stromverlauf beim Pulsumrichter [Quelle: Fischer]<br />
C<br />
DC - Zwischenkreis<br />
Wechselrichter<br />
Als Folge der obligatorischen <strong>Maschinen</strong>induktivitäten verläuft der Strom dabei schon näherungsweise<br />
sinusförmig mit kleinen Oberwellen insbesondere der Pulsfrequenz und Vielfachen davon, während die<br />
Spannung oftmals ein durch Einschwingvorgänge und Leitungsreflexionen zusätzlich verzerrtes<br />
Pulsmuster aufweist.<br />
L1´<br />
L2´<br />
L3´<br />
künstl. Netz<br />
f, U = variabel