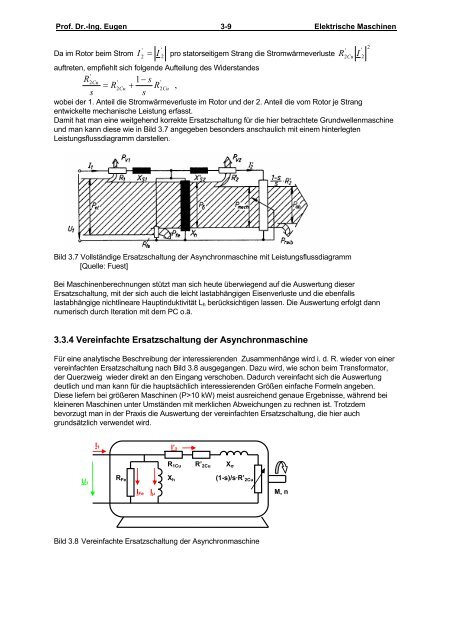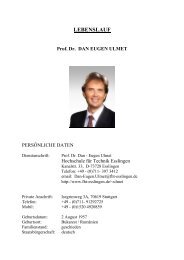Elektrische Maschinen Teil: 1 u. 2
Elektrische Maschinen Teil: 1 u. 2
Elektrische Maschinen Teil: 1 u. 2
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Prof. Dr.-Ing. Eugen 3-9<br />
<strong>Elektrische</strong> <strong>Maschinen</strong><br />
Da im Rotor beim Strom<br />
'<br />
2<br />
'<br />
2<br />
I = I pro statorseitigem Strang die Stromwärmeverluste<br />
'<br />
R2Cu auftreten, empfiehlt sich folgende Aufteilung des Widerstandes<br />
'<br />
R2Cu ' 1− s '<br />
= R2Cu<br />
+ R2Cu<br />
,<br />
s<br />
s<br />
wobei der 1. Anteil die Stromwärmeverluste im Rotor und der 2. Anteil die vom Rotor je Strang<br />
entwickelte mechanische Leistung erfasst.<br />
Damit hat man eine weitgehend korrekte Ersatzschaltung für die hier betrachtete Grundwellenmaschine<br />
und man kann diese wie in Bild 3.7 angegeben besonders anschaulich mit einem hinterlegten<br />
Leistungsflussdiagramm darstellen.<br />
Bild 3.7 Vollständige Ersatzschaltung der Asynchronmaschine mit Leistungsflussdiagramm<br />
[Quelle: Fuest]<br />
Bei <strong>Maschinen</strong>berechnungen stützt man sich heute überwiegend auf die Auswertung dieser<br />
Ersatzschaltung, mit der sich auch die leicht lastabhängigen Eisenverluste und die ebenfalls<br />
lastabhängige nichtlineare Hauptinduktivität Lh berücksichtigen lassen. Die Auswertung erfolgt dann<br />
numerisch durch Iteration mit dem PC o.ä.<br />
3.3.4 Vereinfachte Ersatzschaltung der Asynchronmaschine<br />
Für eine analytische Beschreibung der interessierenden Zusammenhänge wird i. d. R. wieder von einer<br />
vereinfachten Ersatzschaltung nach Bild 3.8 ausgegangen. Dazu wird, wie schon beim Transformator,<br />
der Querzweig wieder direkt an den Eingang verschoben. Dadurch vereinfacht sich die Auswertung<br />
deutlich und man kann für die hauptsächlich interessierenden Größen einfache Formeln angeben.<br />
Diese liefern bei größeren <strong>Maschinen</strong> (P>10 kW) meist ausreichend genaue Ergebnisse, während bei<br />
kleineren <strong>Maschinen</strong> unter Umständen mit merklichen Abweichungen zu rechnen ist. Trotzdem<br />
bevorzugt man in der Praxis die Auswertung der vereinfachten Ersatzschaltung, die hier auch<br />
grundsätzlich verwendet wird.<br />
U 1<br />
I1 I’ 2<br />
R Fe<br />
I Fe I µ<br />
R1Cu R’ 2Cu X σ<br />
Bild 3.8 Vereinfachte Ersatzschaltung der Asynchronmaschine<br />
X h<br />
(1-s)/s·R’ 2Cu<br />
M, n<br />
I<br />
'<br />
2<br />
2