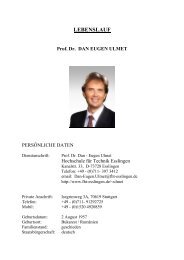Elektrische Maschinen Teil: 1 u. 2
Elektrische Maschinen Teil: 1 u. 2
Elektrische Maschinen Teil: 1 u. 2
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Prof. Dr.-Ing. Eugen 3-24<br />
<strong>Elektrische</strong> <strong>Maschinen</strong><br />
Wird nun der Asynchrongenerator belastet, so benötigt er den zusätzlichen Blindstrom ∆Ib, so dass<br />
- für konstante Spannung die Kapazität C für IC = Ib0 + ∆Ib vergrößert werden muss oder<br />
- die Klemmenspannung zunehmend kleiner wird.<br />
Benötigt die angeschlossene Last selbst Blindleistung, so muss diese zusätzlich durch die<br />
Kondensatoren ausgeglichen werden und zwar muss<br />
- bei L-Last die Kapazität entsprechend vergrößert bzw.<br />
- bei C-Last verkleinert werden.<br />
Ohne diese Korrektur würde die Spannung zusätzlich fallen bzw. ansteigen.<br />
Für eine automatische Spannungsstabilisierung werden daher bei Notstromaggregaten nach Bild 3.21<br />
zusätzlich sog. Sättigungsdrosseln integriert bzw. parallelgeschaltet.<br />
Diese begrenzen durch ihren ausgeprägten Sättigungsknick eine Übererregung des Generators, indem<br />
sie bei einsetzender Sättigung mit ihrem steil ansteigenden Magnetisierungsstrom die resultierende<br />
Kapazität verringern und so für eine befriedigende Spannungskonstanz sorgen.<br />
Bild 3.21 Asynchrongenerator mit Sättigungsdrosseln [Quelle: Fischer]<br />
Eine detaillierte Untersuchung der Asynchrongeneratoren erfolgt ebenfalls im Labor.<br />
3.6.2 Einphasenmotoren<br />
Von wenigen Ausnahmen abgesehen, laufen große Asynchronmotoren immer am Drehstromnetz. Dabei<br />
wird der höhere Installationsaufwand durch die guten Betriebseigenschaften mehr als ausgeglichen.<br />
Demgegenüber steht für kleinere Leistungen oftmals kein Drehstromnetz zur Verfügung. Will man<br />
trotzdem die robuste Asynchronmaschine einsetzen, fällt die Wahl oft auf sog. Einphasenmotoren. Dabei<br />
bezieht sich die Bezeichnung Einphasenmotor in der Regel nur auf den äußeren Anschluss, während<br />
der Motor intern, vom Anwurfmotor abgesehen, zwei- bzw. dreiphasig arbeitet.<br />
3.6.2.1 Drehfeldbildung mit zwei Phasen<br />
Bild 3.22 Drehfeldbildung mit zwei um 90° versetzten Wicklungen<br />
Drehfelder lassen sich nicht nur mit einem Drehstromsystem, sondern auch mit einem Zweiphasen-<br />
System erzeugen. Dazu betrachtet man wieder einen Stator, jetzt aber mit zwei um 90° versetzten,<br />
sinusförmig verteilten Wicklungen gemäß Bild 3.22. Werden diese von sinusförmigen, zeitlich um 90°<br />
verschobenen Strömen gleicher Amplitude durchflossen, so bildet jede Wicklung ein über dem Umfang