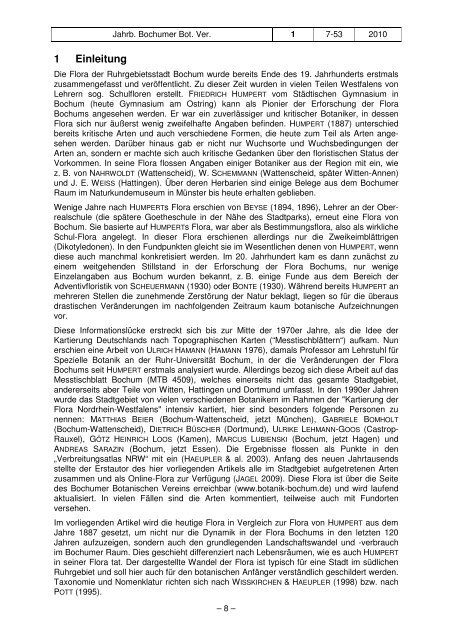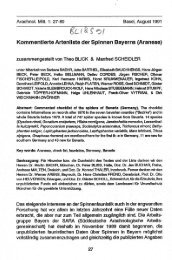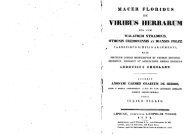in Bochum
in Bochum
in Bochum
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
1 E<strong>in</strong>leitung<br />
Jahrb. <strong>Bochum</strong>er Bot. Ver. 1 7-53 2010<br />
Die Flora der Ruhrgebietsstadt <strong>Bochum</strong> wurde bereits Ende des 19. Jahrhunderts erstmals<br />
zusammengefasst und veröffentlicht. Zu dieser Zeit wurden <strong>in</strong> vielen Teilen Westfalens von<br />
Lehrern sog. Schulfloren erstellt. FRIEDRICH HUMPERT vom Städtischen Gymnasium <strong>in</strong><br />
<strong>Bochum</strong> (heute Gymnasium am Ostr<strong>in</strong>g) kann als Pionier der Erforschung der Flora<br />
<strong>Bochum</strong>s angesehen werden. Er war e<strong>in</strong> zuverlässiger und kritischer Botaniker, <strong>in</strong> dessen<br />
Flora sich nur äußerst wenig zweifelhafte Angaben bef<strong>in</strong>den. HUMPERT (1887) unterschied<br />
bereits kritische Arten und auch verschiedene Formen, die heute zum Teil als Arten angesehen<br />
werden. Darüber h<strong>in</strong>aus gab er nicht nur Wuchsorte und Wuchsbed<strong>in</strong>gungen der<br />
Arten an, sondern er machte sich auch kritische Gedanken über den floristischen Status der<br />
Vorkommen. In se<strong>in</strong>e Flora flossen Angaben e<strong>in</strong>iger Botaniker aus der Region mit e<strong>in</strong>, wie<br />
z. B. von NAHRWOLDT (Wattenscheid), W. SCHEMMANN (Wattenscheid, später Witten-Annen)<br />
und J. E. WEISS (Hatt<strong>in</strong>gen). Über deren Herbarien s<strong>in</strong>d e<strong>in</strong>ige Belege aus dem <strong>Bochum</strong>er<br />
Raum im Naturkundemuseum <strong>in</strong> Münster bis heute erhalten geblieben.<br />
Wenige Jahre nach HUMPERTs Flora erschien von BEYSE (1894, 1896), Lehrer an der Oberrealschule<br />
(die spätere Goetheschule <strong>in</strong> der Nähe des Stadtparks), erneut e<strong>in</strong>e Flora von<br />
<strong>Bochum</strong>. Sie basierte auf HUMPERTs Flora, war aber als Bestimmungsflora, also als wirkliche<br />
Schul-Flora angelegt. In dieser Flora erschienen allerd<strong>in</strong>gs nur die Zweikeimblättrigen<br />
(Dikotyledonen). In den Fundpunkten gleicht sie im Wesentlichen denen von HUMPERT, wenn<br />
diese auch manchmal konkretisiert werden. Im 20. Jahrhundert kam es dann zunächst zu<br />
e<strong>in</strong>em weitgehenden Stillstand <strong>in</strong> der Erforschung der Flora <strong>Bochum</strong>s, nur wenige<br />
E<strong>in</strong>zelangaben aus <strong>Bochum</strong> wurden bekannt, z. B. e<strong>in</strong>ige Funde aus dem Bereich der<br />
Adventivfloristik von SCHEUERMANN (1930) oder BONTE (1930). Während bereits HUMPERT an<br />
mehreren Stellen die zunehmende Zerstörung der Natur beklagt, liegen so für die überaus<br />
drastischen Veränderungen im nachfolgenden Zeitraum kaum botanische Aufzeichnungen<br />
vor.<br />
Diese Informationslücke erstreckt sich bis zur Mitte der 1970er Jahre, als die Idee der<br />
Kartierung Deutschlands nach Topographischen Karten (“Messtischblättern“) aufkam. Nun<br />
erschien e<strong>in</strong>e Arbeit von ULRICH HAMANN (HAMANN 1976), damals Professor am Lehrstuhl für<br />
Spezielle Botanik an der Ruhr-Universität <strong>Bochum</strong>, <strong>in</strong> der die Veränderungen der Flora<br />
<strong>Bochum</strong>s seit HUMPERT erstmals analysiert wurde. Allerd<strong>in</strong>gs bezog sich diese Arbeit auf das<br />
Messtischblatt <strong>Bochum</strong> (MTB 4509), welches e<strong>in</strong>erseits nicht das gesamte Stadtgebiet,<br />
andererseits aber Teile von Witten, Hatt<strong>in</strong>gen und Dortmund umfasst. In den 1990er Jahren<br />
wurde das Stadtgebiet von vielen verschiedenen Botanikern im Rahmen der "Kartierung der<br />
Flora Nordrhe<strong>in</strong>-Westfalens" <strong>in</strong>tensiv kartiert, hier s<strong>in</strong>d besonders folgende Personen zu<br />
nennen: MATTHIAS BEIER (<strong>Bochum</strong>-Wattenscheid, jetzt München), GABRIELE BOMHOLT<br />
(<strong>Bochum</strong>-Wattenscheid), DIETRICH BÜSCHER (Dortmund), ULRIKE LEHMANN-GOOS (Castrop-<br />
Rauxel), GÖTZ HEINRICH LOOS (Kamen), MARCUS LUBIENSKI (<strong>Bochum</strong>, jetzt Hagen) und<br />
ANDREAS SARAZIN (<strong>Bochum</strong>, jetzt Essen). Die Ergebnisse flossen als Punkte <strong>in</strong> den<br />
„Verbreitungsatlas NRW“ mit e<strong>in</strong> (HAEUPLER & al. 2003). Anfang des neuen Jahrtausends<br />
stellte der Erstautor des hier vorliegenden Artikels alle im Stadtgebiet aufgetretenen Arten<br />
zusammen und als Onl<strong>in</strong>e-Flora zur Verfügung (JAGEL 2009). Diese Flora ist über die Seite<br />
des <strong>Bochum</strong>er Botanischen Vere<strong>in</strong>s erreichbar (www.botanik-bochum.de) und wird laufend<br />
aktualisiert. In vielen Fällen s<strong>in</strong>d die Arten kommentiert, teilweise auch mit Fundorten<br />
versehen.<br />
Im vorliegenden Artikel wird die heutige Flora <strong>in</strong> Vergleich zur Flora von HUMPERT aus dem<br />
Jahre 1887 gesetzt, um nicht nur die Dynamik <strong>in</strong> der Flora <strong>Bochum</strong>s <strong>in</strong> den letzten 120<br />
Jahren aufzuzeigen, sondern auch den grundlegenden Landschaftswandel und -verbrauch<br />
im <strong>Bochum</strong>er Raum. Dies geschieht differenziert nach Lebensräumen, wie es auch HUMPERT<br />
<strong>in</strong> se<strong>in</strong>er Flora tat. Der dargestellte Wandel der Flora ist typisch für e<strong>in</strong>e Stadt im südlichen<br />
Ruhrgebiet und soll hier auch für den botanischen Anfänger verständlich geschildert werden.<br />
Taxonomie und Nomenklatur richten sich nach WISSKIRCHEN & HAEUPLER (1998) bzw. nach<br />
POTT (1995).<br />
– 8 –