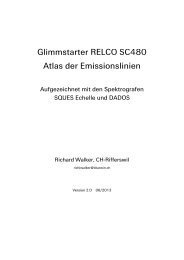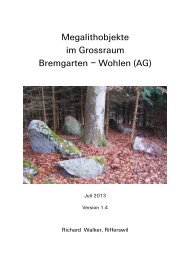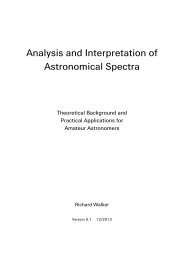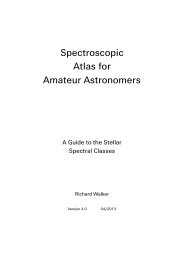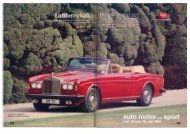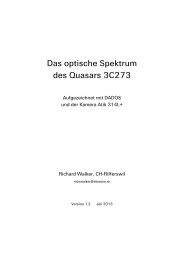Spektralatlas für Astroamateure - UrsusMajor
Spektralatlas für Astroamateure - UrsusMajor
Spektralatlas für Astroamateure - UrsusMajor
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
<strong>Spektralatlas</strong> <strong>für</strong> <strong>Astroamateure</strong> 103<br />
Für niedrige Anregungsklassen E1 – E4: / <br />
Bei den höheren Stufen (: 4 − 12) wird ab der Übergangsklasse 4 [205] erstmals die He II<br />
Linie bei λ4686 sichtbar. Diese Ionen erfordern zu ihrer Erzeugung 24.6 eV, entsprechend<br />
ca. 50‘000K [202]. Das ist fast die doppelte Energie wie <strong>für</strong> H II mit 13.6 eV. Diese Linie<br />
steigert ab hier die Intensität und ersetzt die stagnierende Hβ Emission als Vergleichswert<br />
in der Formel. Das Verhältnis wird ab hier logarithmisch (zur Basis 10) ausgedrückt, um den<br />
Wertebereich <strong>für</strong> das Klassierungssystem auf einen vernünftigen Bereich zu limitieren:<br />
Für mittlere und hohe Anregungsklassen E4 – E12: log( / ())<br />
Die 12 -Klassen werden in die Gruppen Niedrig ( =1−4), Mittel ( = 4 − 8) und Hoch<br />
(=8−12) unterteilt. In Extremfällen wird noch 12 + vergeben.<br />
Niedrig Mittel Hoch<br />
–Klasse / –Klasse log( / ) –Klasse log( / )<br />
E1 0 – 5 E4 2.6 E9 1.7<br />
E2 5 – 10 E5 2.5 E10 1.5<br />
E3 10 – 15 E6 2.3 E11 1.2<br />
E4 >15 E7 2.1 E12 0.9<br />
E8 1.9 E12 + 0.6<br />
24.4 Hinweise zur Spektralaufnahme und Bestimmung der Anregungsklasse<br />
Die Bestimmung der niedrigen E-Klassen 1–4 ist einfach, da hier die Hβ Linie, im Verhältnis<br />
zu den [O III] Emissionen, relativ intensiv bleibt. Ab Stufe E4 beginnt die He II Linie (λ4686)<br />
zuerst schwach und erfordert sehr rauscharme Spektren, sowie starkes Zoomen in der Intensitätsachse.<br />
Am einfachsten zu spektroskopieren sind die scheibchenförmig und blaugrün scheinenden<br />
PN. Sie sind dadurch innerhalb einer Sterngruppe sehr leicht zu finden und die Belichtungszeit<br />
beträgt bei den hellen Vertretern nur wenige Minuten (200L Reflexionsgitter). Die<br />
hellste [O III] Linie erscheint oft schon nach einigen Sekunden auf dem Bildschirm (z.B. NGC<br />
6210)! Die Intensität der Linien wird bei so klein erscheinenden Objekten über den sehr<br />
kurzen, ausgeleuchteten Spaltbereich integriert. Entlang dieses winzig erscheinenden<br />
Scheibchendurchmessers zeigen aber die einzelnen Linien beträchtliche Intensitätsunterschiede<br />
(siehe Kap. 24.7). Zudem sind während langen Belichtungszeiten,<br />
infolge von Seeing- und Nachführungseinflüssen, leichte Veränderungen<br />
der Spaltposition bezüglich des Nebels zu beobachten. Versuche<br />
haben gezeigt, dass die Auswertung mehrer Spektren desselben<br />
Objektes signifikant unterschiedliche Ergebnisse zeigen können, wobei<br />
auch das Balmerdekrement betroffen ist. Dabei war aber nur ein geringer<br />
Einfluss auf die Anregungsklasse festzustellen! Das Bild zeigt den<br />
Spirographnebel (IC 418) auf dem 25μm Spalt (PHD Guiding). Zwischen<br />
dem grünen Autoguiding Kreuz und dem Spalt ist noch der helle<br />
Zentralstern erkennbar.<br />
Die grossflächig erscheinenden Nebel wie M27 und M57 benötigen hingegen mit einem<br />
C8 und der Meade DSI III mindestens 20–30 Minuten Belichtungszeit (ohne Binning) und<br />
einen absolut dunst- und wolkenfreien Himmelsabschnitt. Sie erlauben aber das selektive<br />
Spektroskopieren ausgewählter Nebelbereiche sowie die Analyse des Intensitätsverlaufs<br />
entlang des Spaltes (siehe 24.7). In diesen Fällen zeigten mehre Spektren desselben Objektes<br />
immer konsistente Resultate.