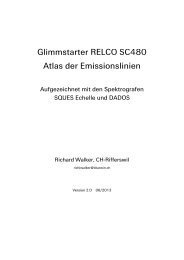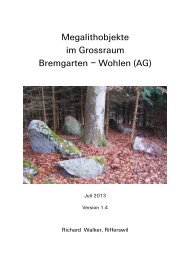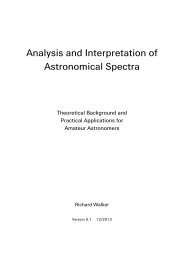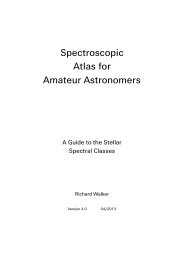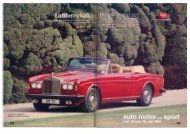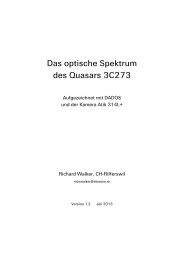Spektralatlas für Astroamateure - UrsusMajor
Spektralatlas für Astroamateure - UrsusMajor
Spektralatlas für Astroamateure - UrsusMajor
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
<strong>Spektralatlas</strong> <strong>für</strong> <strong>Astroamateure</strong> 9<br />
2 Auswahl, Aufbereitung und Darstellung der Spektren<br />
2.1 Auswahl<br />
Hauptkriterien <strong>für</strong> die Auswahl der Spektren waren die Dokumentation der spektralen<br />
Merkmale, sowie die Demonstration von Effekten, z.B. infolge der unterschiedlichen<br />
Leuchtkraftklassen. Die Berücksichtigung allgemein bekannter, heller Fixsterne war dabei<br />
zweitrangig. Grundsätzlich wird jede Spektralklasse mindestens mit einem frühen und späten<br />
Vertreter vorgestellt, um die Entwicklung charakteristischer Merkmale zeigen zu können.<br />
Weiter wurden auch einige stellare „Exoten“, und Nebelspektren berücksichtigt. In separaten<br />
Kapiteln sind noch Komposit Spektren von Galaxien, Reflexionsspektren von diversen<br />
Körpern im Sonnensystem, Absorptionsbanden der Erdatmosphäre und einige Profile<br />
terrestrischer Lichtquellen kommentiert.<br />
2.2 Aufnahme und Auflösung der Spektren<br />
Die Spektren wurden mit dem DADOS Spektrografen [603] sowie den Gittern 200- und<br />
900 L/mm aufgenommen. Wenn nichts anderes vermerkt ist, erfolgten die Aufnahmen<br />
durch das 8 Zoll Teleskop Celestron C8 und den 25μm Spalt des Spektrografen. Die Aufzeichnung<br />
erfolgte schliesslich mit der monochromen Kamera Meade DSI III Pro. Die Spektren<br />
auf den Tafeln 5 (WR133), 70 und 84 wurden zusammen mit Martin Huwiler im Nasmith<br />
Fokus des CEDES Cassegrain 90 cm Teleskops der Sternwarte Mirasteilas in Falera<br />
aufgenommen (siehe Anhang 33.4). Verschiedene Beispiele belegen aber, dass diese Objekte<br />
mit längerer Belichtungszeit auch <strong>für</strong> durchschnittliche Amateurausrüstungen erreichbar<br />
sind!<br />
Die Auswertung mit Vspec ergibt mit dem 900L Gitter eine Dispersion von ca. 0.65 Å/Pixel<br />
und 2.55 Å/Pixel mit dem 200L Gitter. Daten des Sony Chip ICX285AL: 1.4 Megapixel,<br />
2/3" Monochrom CCD, Pixelgrösse 6.45μm x 6.45μm [606]. Bei längeren Belichtungszeiten<br />
erfolgte ein Dunkelbildabzug. Auf die Verarbeitung von „Flatfields“ wurde verzichtet.<br />
Der R-Wert, d.h. die Auflösung des DADOS Spektrografen entspricht gemäss Manual<br />
= 3000 bei 5610 Å und = 650 bei 6160 Å. Eigene Messungen mit gemittelten<br />
FWHM Werten mehrerer Neon Kalibrieremissionen ergaben in diesem Bereich R-Werte in<br />
der Grössenordnung von = 4000 resp. = 900. Diese Auflösungen haben sich <strong>für</strong><br />
die Präsentation der Spektralklassen als ideal erwiesen. Wesentlich höhere R-Werte würden<br />
hier zunehmend dem Lesen einer Zeitung mit dem Mikroskop entsprechen. Es überrascht<br />
daher nicht, dass Gray/Corbally [2] Profile mit einer Auflösung von ~3 Å als<br />
„classification resolution spectra“ bezeichnen. Auch die professionelle Astronomie verwendet<br />
<strong>für</strong> bestimmte Aufgaben Spektrografen niederer Auflösung!<br />
2.3 Aufbereitung der Spektren<br />
Die Aufbereitung der fits Monochrombilder erfolgte standardmässig mit IRIS [550]. In den<br />
meisten Fällen erfolgte zur Rauschreduktion ein „Stacking“ von ca. 5–7 Spektralprofilen.<br />
Die Erzeugung und Auswertung des definitiven Profils wurde dann mit Vspec [551] durchgeführt.<br />
Die hier angewendeten Prozesse sind in [31] detailliert dargestellt.<br />
Bei allen breitbandigen Spektren wurde, mit Ausnahme von M31, der hier sonst nicht interessierende<br />
Verlauf des Pseudokontinuums mittels Division durch den eigenen Verlauf entfernt.<br />
So werden die Linienintensitäten über den gesamten Bereich optisch vergleichbar<br />
und es resultiert eine platzsparende und übersichtliche „Flachdarstellung“. Massgebend <strong>für</strong><br />
den Intensitätsvergleich ist die relative Tiefe oder Höhe der Linie im Verhältnis zur dort gemessenen<br />
Kontinuumshöhe über der Wellenlängenachse. Der Verlauf des Pseudokontinuums<br />
bewirkt, dass am „blauen“ und „roten“ Ende des Spektrums, intensive Linien optisch<br />
stark verkümmert und umgekehrt schwache im Zentrum überhöht wirken. Gerade diese