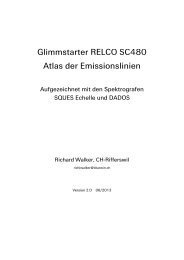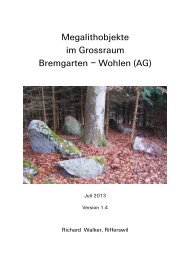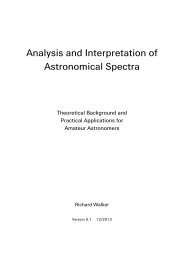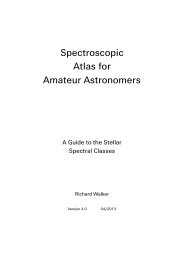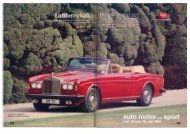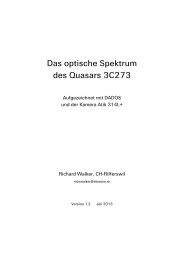Spektralatlas für Astroamateure - UrsusMajor
Spektralatlas für Astroamateure - UrsusMajor
Spektralatlas für Astroamateure - UrsusMajor
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
<strong>Spektralatlas</strong> <strong>für</strong> <strong>Astroamateure</strong> 65<br />
16 Spektralklasse G<br />
16.1 Überblick<br />
Die gelblich scheinenden Sterne der G-Klasse geniessen, spektralanalytisch gesehen, einen<br />
Sonderstatus, da sie unserer Sonne, mit dem wohl am besten erforschten und dokumentierten<br />
Spektrum, mehr oder weniger ähnlich sind. Am Südsternhimmel ist α Centauri mit G2V<br />
gleich klassiert wie die Sonne. Dessen Oberflächentemperatur ist auch etwa gleich hoch<br />
wie bei unserem Zentralgestirn. Am Nordsternhimmel ist Muphrid (η Boo) mit G0 IV relativ<br />
nahe zur Sonne eingestuft. Sonst sind hier unter den helleren Sternen kaum direkte „Klassenkollegen“<br />
unseres Zentralgestirns zu finden. Capella ist mit seinen beiden Doppelsternkomponenten<br />
G5llle und G0lll im HRD bereits auf dem Riesenast angesiedelt. Dasselbe gilt<br />
mit G0lb auch <strong>für</strong> Sadalsuud (β Aqr).<br />
Weitere namhafte G-Sterne sind erst in den Klassen G7 und später zu finden, wie Kornephoros<br />
(β Her), γ Leo, γ Per, δ Boo, Vindemiatrix (ε Vir).<br />
16.2 Eckdaten der frühen bis späten G Klassen<br />
Die folgende Tabelle zeigt die Daten exklusiv <strong>für</strong> die Hauptreihensterne der G-Klasse im<br />
Vergleich zur Sonne () gem. [701].<br />
Masse<br />
M/M<br />
Verweildauer auf<br />
Hauptreihe [J]<br />
Temperatur<br />
Photosphäre [K]<br />
Radius<br />
R/R<br />
Leuchtkraft<br />
L/L<br />
1.05 – 0.9 7 – 15 Mrd 6‘000 – 5‘500 1.1 – 0.85 1.5 – 0.66<br />
Auffällig ist der prozentual sehr geringe Massenbereich, welcher durch diese Klasse abgedeckt<br />
wird. Trotzdem reagieren darauf die Lebenserwartung und Leuchtkraft des Sterns<br />
fast grotesk empfindlich. Unsere Sonne gehört mit G2V zur frühen G-Klasse. Ihre Verweildauer<br />
auf der Hauptreihe beträgt ca. 7 Mrd. Jahre und die Oberflächentemperatur ca.<br />
5800 K.<br />
16.3 Spektrale Merkmale der G-Klasse<br />
Die Fraunhofer H+K Linien des ionisierten Ca II werden hier eindrücklich stark und erreichen<br />
theoretisch etwa bei den späten G-Klassen ihre maximale Intensität. Dies ist auch im<br />
Diagramm in Kap. 6 ersichtlich. Im Sonnenspektrum (G2V) bilden sie denn auch die mit Abstand<br />
stärksten, vom Stern selbst erzeugten Spektrallinien. Dabei ist bei den Hauptreihesternen<br />
der G-Klasse die K- Linie immer leicht intensiver als die H-Linie.<br />
Die H-Balmerlinien werden deutlich schwächer, sodass sie jetzt sogar von diversen Metallabsorptionen<br />
übertrumpft werden. Sie verlieren deshalb ab hier die Bedeutung als willkommene<br />
Orientierungsmarken, z.B. bei der Kalibrierung und Linienidentifikation.<br />
Die Intensität des sog. Magnesium Triplets (λ 5169–83) hat bereits während der F-Klasse<br />
zugenommen und erreicht hier eine beachtliche Stärke, sodass es mit „b“ sogar eine eigene<br />
Fraunhoferbezeichnung erhalten hat. Die bei den frühen und mittleren F-Klassen erst<br />
schwach sichtbare Ca l Linie (λ 4227), wird jetzt ebenfalls deutlich stärker und trägt die<br />
Fraunhoferbezeichnung „g“.<br />
Generell wird hier der Trend der F-Klasse fortgesetzt, dass die Linien der neutralen Metalle,<br />
z.B. Fe I und die Fraunhofer D-Linien (Na I), intensiver werden. Gegen die späteren Subklassen<br />
ersetzen sie zunehmend die Absorptionen der ionisierten Elemente. Durch die Dominanz<br />
der feinen Metallinien werden die Spektren jetzt zunehmend komplexer und unüber-