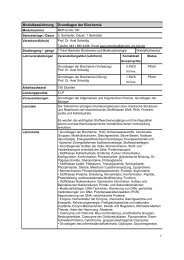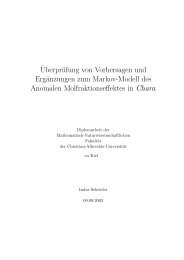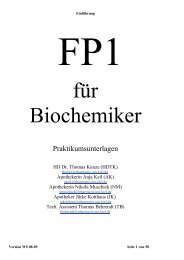Kapitel 6 Entwurf des Reglers auf endliche Einstellzeit - Christian ...
Kapitel 6 Entwurf des Reglers auf endliche Einstellzeit - Christian ...
Kapitel 6 Entwurf des Reglers auf endliche Einstellzeit - Christian ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
16<br />
angenommen werden, so daß die Intensität der Fluoreszenz als Meßgröße den Pegelstand im<br />
Exzitonensee abbildet.<br />
Das Topfmodell geht von den Annahmen <strong>des</strong> Matrix-Modells aus, daß die einzelnen PS II<br />
Photosysteme stark gekoppelt sind. Die Alternative ist das Separate Unit Modell (Dau, 1994),<br />
doch diese Unterschiede sind für die vorliegende Arbeit nicht relevant.<br />
Nach dem Matrix-Modell, ergibt sich folgender Zusammenhang zwischen der Höhe <strong>des</strong><br />
Exzitonensees und seinen Abflüssen (Dau, 1989, 1994):<br />
aI<br />
E = (3.1.)<br />
k + k k [Q ]<br />
f t<br />
+<br />
p<br />
A<br />
mit E : Höhe <strong>des</strong> Exzitonensees<br />
a : mittlerer Absorptionsquerschnitt der Photosysteme II<br />
I : Intensität <strong>des</strong> Anregungslichtes<br />
k f : Ratenkonstante der Fluoreszenz<br />
k t : Ratenkonstante der thermischen Deaktivierung<br />
k p : Ratenkonstante der photochemischen Deaktivierung<br />
[Q A ]: Konzentration an nichtreduziertem Quencher QA<br />
Aufgrund der Konstanz der Ratenkonstante der Fluoreszenz k f ergibt sich daraus die<br />
Fluoreszenz F zu:<br />
kf<br />
F = kf<br />
E =<br />
aI<br />
(3.2)<br />
k + k + k [Q ]<br />
f<br />
t<br />
p<br />
A<br />
In dieser Formel tauchen folgende Quenchingmechanismen <strong>auf</strong>:<br />
• Verminderung <strong>des</strong> Absorptionsquerschnittes a der PS II,<br />
• Anwachsen der thermischen Deaktivierung k t ,<br />
• Erhöhung der photochemischen Aktivität k p .<br />
Die Wirkung von a und k t bezeichnet man als nichtphotochemisches Quenching q N und die<br />
Erhöhung von k p als photochemisches Quenching q P .<br />
Nichtphotochemisches Quenching schützt die Pflanze vor zu hoher Lichtintensität.<br />
• Das zu a gehörende State-transition-Quenching q T hängt damit zusammen, daß die<br />
beweglichen LHCs zwischen den Photosystemen II und I umverteilt werden, um eine<br />
bessere Anpassung an das Lichtspektrum und den Lichtbedarf von PS I und PS II zu<br />
erreichen. Die Veränderung <strong>des</strong> Absorptionsquerschnittes a dauert 3 bis 10 min (Dau und<br />
Hansen, 1988; Dau, 1989; Dau und Canaani, 1990).