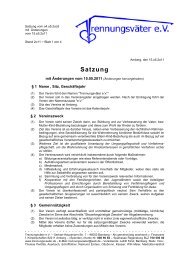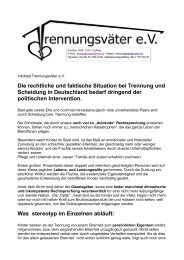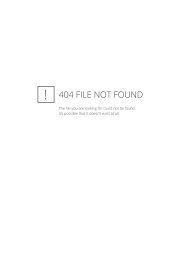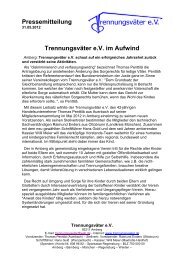PAS - das Recht des Kindes auf beide Elternteile
PAS - das Recht des Kindes auf beide Elternteile
PAS - das Recht des Kindes auf beide Elternteile
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
16 Kritische Stellungnahme zum <strong>PAS</strong>-Konzept 109<br />
The Parental Alienation Syndrome<br />
strengen Kriterien der durch Fachkollegen referierten Bücher entsprechen. Jedoch<br />
ist es üblich, Bücher im eigenen Verlag zu veröffentlichen, ohne daraus<br />
Rückschlüsse <strong>auf</strong> die Reputation <strong>des</strong> Themas <strong>des</strong> Buches ziehen zu können (vgl.<br />
Warshak 2003, S. 221).<br />
Auf seiner Internetseite www.rgardner.com befindet sich eine Liste mit<br />
Veröffentlichungen Gardners, welche in sozialwissenschaftlichen, psychiatrischen<br />
etc. Fachkreisen referiert wurden (vgl. www.rgardner.com), diese Liste mit 21<br />
Einträgen verdeutlicht, <strong>das</strong>s <strong>PAS</strong>, trotz gegenteiliger Aussagen der Kritiker, ein<br />
wissenschaftlich referiertes Phänomen ist. Weiterhin zeigt diese Liste <strong>auf</strong>, <strong>das</strong>s<br />
auch durchaus Artikel anderer Autoren zu <strong>PAS</strong> entsprechende Referenzen<br />
<strong>auf</strong>weisen können, was den Grad der wissenschaftlichen Anerkennung von <strong>PAS</strong><br />
nochmals unterstreicht (vgl. www.rgardner.com und Warshak 2003, S. 221).<br />
16.4 Weitere Kritikpunkte<br />
Des Weiteren beklagen Kritiker die Einfachheit <strong>des</strong> <strong>PAS</strong>-Konzeptes. Sie<br />
behaupten, <strong>das</strong>s die Diagnose <strong>PAS</strong> „lediglich an der äußeren Kontaktbereitschaft<br />
<strong>des</strong> Kin<strong>des</strong> festgemacht wird.“ (Figidor 2003, S. 190) und innerpsychische<br />
Variablen, welche die Kontaktbereitschaft evtl. verhindern könnten, außer Acht<br />
gelassen werden. Die Kritiker geben an, <strong>das</strong>s Kinder eine Vielzahl von<br />
innerpsychischen Gründen haben können, den Kontakt zu einem Elternteil zu<br />
verweigern. So entwickeln z. B. einige Kinder nach der Trennung der Eltern einen<br />
unerträglich starken Loyalitätskonflikt, welcher sie dazu zwingt, den zur Zeit<br />
weniger wichtigen Elternteil <strong>auf</strong>zugeben, um nicht ständig zwischen <strong>beide</strong>n<br />
<strong>Elternteile</strong>n hin- und hergerissen zu sein. Die Bestärkung dieses Verhaltens durch<br />
den gebliebenen Elternteil suggeriert dem Kind, die richtige Entscheidung<br />
getroffen zu haben und führt somit zu einer vollkommenen und lang anhaltenden<br />
Abkehr vom <strong>auf</strong>gegebenen Elternteil (vgl. Figidor 2003, S. 193). Andere Kinder<br />
finden einfach keinen Gefallen an den Besuchen beim außerhalb lebenden<br />
Elternteil, da dieser beispielsweise zuviel mit dem Kind unternimmt, was <strong>das</strong> Kind<br />
als störend und stressig empfindet oder der Vater versucht in der wenigen Zeit, die<br />
ihm mit seinem Kind bleibt, <strong>des</strong>sen gesamte Erziehung zu verändern bzw. zu<br />
verbessern, was dem betroffenen Kind selbstverständlich nicht gefällt (vgl. Figidor<br />
2003, S. 195f). Kleinere Kinder empfinden beim Übergang von der Mutter zum