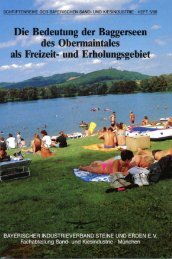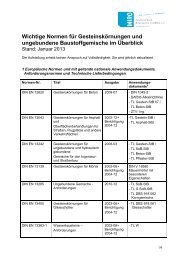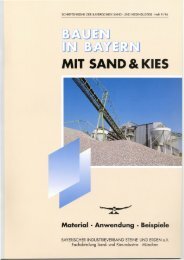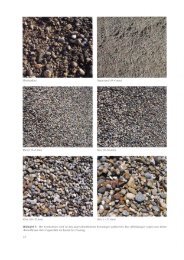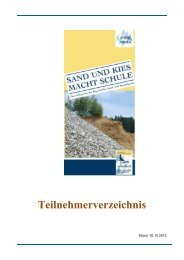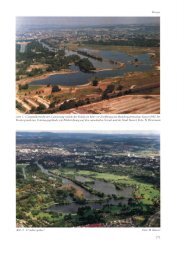Das Grundwasser im schwäbischen Donautal - Bayerischer ...
Das Grundwasser im schwäbischen Donautal - Bayerischer ...
Das Grundwasser im schwäbischen Donautal - Bayerischer ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Für die Infiltration ist nicht nur die absolute Niederschlagssumme, sondern auch die zeitliche Verteilung<br />
der Niederschlagsmenge von Bedeutung. Im allgemeinen wirken sich lang andauernde<br />
Regenfälle günstiger auf die Infiltration des Niederschlags aus. Dagegen tragen einzelne Starkregenereignisse,<br />
z. B. starke Gewitterregen, die innerhalb kurzer Zeit hohe Niederschlagsmengen<br />
liefern, verhältnismäßig wenig zur Infiltration in den Boden bei und fließen meist auf der Oberfläche<br />
in den Vorfluter ab.<br />
Verdunstung<br />
Die Verdunstung hat einen entscheidenden Einfluß auf die Wasserbilanz. Ein beträchtlicher Teil des<br />
Niederschlages wird in Form von Wasserdampf an die Atmosphäre abgegeben und ist somit nicht<br />
am Abflußgeschehen beteiligt. Einflußfaktoren auf die Verdunstung sind neben den kl<strong>im</strong>atischen<br />
Faktoren, der Bewuchs und das Wasserdargebot der betrachteten Flächen. Für die Berechnung der<br />
Verdunstungshöhe wird zwischen der potentiellen Verdunstung 0/poJ und der reellen Verdunstung<br />
0lree 11<br />
} unterschieden, die beide <strong>im</strong> Programm MODBIL errechnet wurden.<br />
Für das Blatt 7527 Günzburg ergibt sich eine mittlere potentielle Verdunstung von 523 mm/a, wovon<br />
417,5 mm auf das Sommerhalbjahr und 105,5 mm auf das Winterhalbjahr entfallen.<br />
<strong>Grundwasser</strong>neubildung und Wasserbilanz für das Blatt Günzburg<br />
Die <strong>Grundwasser</strong>neubildung ergibt sich aus der Wasserbilanz für das Modellgebiet Für das Blatt<br />
Günzburg ergibt sich <strong>im</strong> langjährigen Mittel (20 Jahre) ein Jahresniederschlag von 802 mm, was<br />
einem Monatsmittel von 67 mm entspricht. Hiervon entfallen auf das Winterhalbjahr 329 mm (41 %)<br />
und auf das Sommerhalbjahr 473 mm (59%).<br />
ln Tab. 12 ist die Wasserbilanz für eine unbewaldete Fläche dargestellt. Es sind zwei wichtige Einflußparameter<br />
auf den Wasserhaushalt erkennbar:<br />
- Die nutzbare Feldkapazität beeinflußt die reelle Verdunstung, die <strong>im</strong> Beispielgebiet zwischen<br />
450 und 500 mm/a schwankt.<br />
- Die Durchlässigkeit des Oberbodens, ausgedrückt durch die Bodenklassen, steuert die Höhe der<br />
Infiltration und des Oberflächenabflusses. Letzterer schwankt je nach geologischer Einheit zwischen<br />
66 mm/a für Moorflächen mit großer nutzbarer Feldkapazität und 331 mm/a für versiegelte<br />
Flächen.<br />
Die <strong>Grundwasser</strong>neubildung errechnet sich nach der hydrologischen Grundgleichung aus dem<br />
Niederschlag, der reellen Verdunstung und dem Oberflächenabfluß. Durch deren Zusammenwirken<br />
schwankt die Höhe der <strong>Grundwasser</strong>neubildung <strong>im</strong> betrachteten Teilraum zwischen 49 mm/a<br />
in Stadtkernen und 263 mm/a für geringmächtige Böden ohne Waldbedeckung über Malm<br />
(nFK = 60 mm).<br />
Aufgrund der Berechnungsroutine von MODBIL können die Ergebnisse der Wasserhaushaltsberechnung<br />
auch als Monatswerte ausgewiesen werden. Der zeitliche Verlauf der Wasserhaushaltsgrößen<br />
ist in Abb. 17 am Beispiel der Lößfläche aus Tab. 12 (nFK 180 , Bodenzahl 2,5) dargestellt.<br />
64