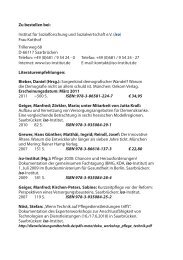iso-NEWS - Institut für Sozialforschung und Sozialwirtschaft eV
iso-NEWS - Institut für Sozialforschung und Sozialwirtschaft eV
iso-NEWS - Institut für Sozialforschung und Sozialwirtschaft eV
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Manfred Geiger: Ausgrenzung <strong>und</strong> Integration – historische Wendepunkte in der Sozialpolitik<br />
___________________________________________________________________________________________<br />
Die soziale Frage war mittlerweile selbst<br />
<strong>für</strong> Bismarck zu einem Problem von nationaler<br />
Bedeutung geworden. Der Reichsgründung<br />
durch „Blut <strong>und</strong> Eisen“ sollte eine<br />
„innere Reichsgründung“ folgen; mithin<br />
eine Politik der sozialen Reformen, die zur<br />
Integration eines sich immer mehr differenzierenden<br />
Volkes führt (vgl. Pankoke/Sachße<br />
1992: 154). Nur dann, davon war Bismarck<br />
überzeugt, könnte das Reich alle<br />
Ressourcen einer aufstrebenden Industrienation<br />
mobilisieren <strong>und</strong> sich im Konzert der<br />
sich formierenden Großmächte behaupten.<br />
Zentrale Elemente der Bismarckschen<br />
Reformpolitik - sie markiert erneut eine<br />
Wende - sind der Ausbau eines kollektiven<br />
Arbeitsrechts, die Einführung der Sozialversicherung,<br />
später, vor allem in den Zeiten<br />
der Weimarer Republik dann die Weiterentwicklung<br />
der Fürsorge bis zu einer<br />
kommunalen Daseinsvorsorge <strong>und</strong> Wohlfahrtspflege,<br />
die über die Unterschichten<br />
hinaus breiten Kreisen der Bevölkerung<br />
zukam. Damit waren die Gr<strong>und</strong>strukturen<br />
des heutigen Wohlfahrtstaates geschaffen.<br />
Die Krise <strong>und</strong> die Problematisierung<br />
der „Ballastexistenzen“<br />
Diese Entwicklung verlief nicht gradlinig.<br />
Der neuralgische Punkt <strong>für</strong> die Aufrechterhaltung<br />
der Wohlfahrtskonzeption war der<br />
Arbeitsmarkt. Das musste man vor allem<br />
am Ende der Weimarer Republik erfahren.<br />
Als buchstäblich immer mehr Menschen<br />
auf der Straße standen, gerieten auch die<br />
Gr<strong>und</strong>pfeiler des Wohlfahrtsstaates ins<br />
Wanken: Die auf Ausgleich zwischen Arbeit<br />
<strong>und</strong> Kapital angelegte Betriebs- <strong>und</strong> Arbeiterschutzpolitik,<br />
die lohnarbeitszentrierte<br />
Sozialversicherungspolitik, die steuerfinanzierte<br />
Fürsorgepolitik.<br />
16<br />
<strong>iso</strong>-Mitteilungen Nr. 3/August 2004<br />
Die vielen Spannungen, die das System<br />
der Wohlfahrtspflege unter dem Eindruck<br />
schwindender Ressourcen, die auf immer<br />
mehr Hilfebedürftige zu verteilen waren,<br />
auszuhalten hatte <strong>und</strong> letztlich doch nicht<br />
verkraften konnte, entluden sich in einer<br />
schärfer werdenden Kritik am Umgang mit<br />
den so genannten „Ballastexistenzen“, wie<br />
nun die Menschen, mit denen sich das<br />
Hilfesystem besonders schwer tat, genannt<br />
wurden (vgl. Ayaß 1995:13). Gemeint waren<br />
Hilfebedürftige, die, weil offenbar ohne<br />
Aussicht auf eine Erfolg versprechende<br />
Besserung, der Gesellschaft <strong>und</strong> sich selbst,<br />
vor allem aber den sie betreuenden Einrichtungen,<br />
eigentlich nur noch zur Last<br />
fielen. Ihnen, so wurde moniert, würde<br />
aufwendige Hilfe zuteil, obwohl sie diese,<br />
wie etwa „Arbeitsscheue“ <strong>und</strong> „Asoziale“<br />
gar nicht verdient hätten. Oder: Eine erzieherische<br />
Beeinflussung <strong>und</strong> Besserung, wie<br />
sie mit der Unterstützung einhergehen sollte,<br />
wäre schon auf Gr<strong>und</strong> einer geistigen<br />
oder seelischen Behinderung, einer sittlichen<br />
Verwahrlosung von vorneherein aussichtslos.<br />
Dann aber, so die fatale Schlussfolgerung,<br />
könne man sich auch den Hilfeaufwand<br />
sparen oder auf ein Minimum<br />
beschränken bzw. sich ganz auf einen<br />
besänftigenden Umgang mit dieser als<br />
schwierig empf<strong>und</strong>enen Klientel konzentrieren.<br />
Da<strong>für</strong> stand der Terminus technicus<br />
„Bewahrungs<strong>für</strong>sorge“.<br />
Mit den rassistischen Untertönen, die, als<br />
die Ohnmacht des ausgezehrten Wohlfahrtsstaates<br />
offensichtlicher wurde, auch<br />
in der breiten Öffentlichkeit immer mehr<br />
Resonanz fanden, gewann die Problematisierung<br />
der so genannten „Ballastexistenzen“<br />
zusätzlich an Schärfe. Hier müsse, so<br />
wurde es schon am Ende der Weimarer<br />
Republik unverblümt propagiert - <strong>und</strong> zwar