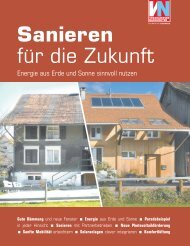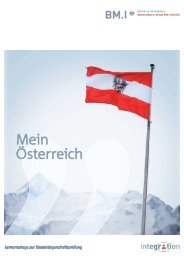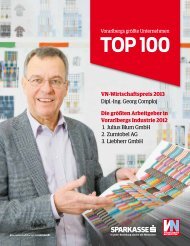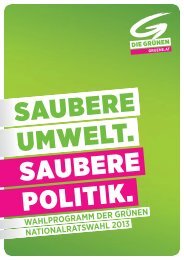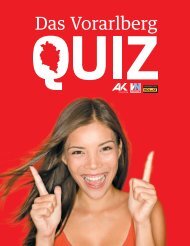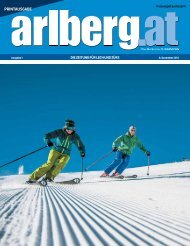SPRACHE BILDUNG INTEGRATION - Vorarlberg Online
SPRACHE BILDUNG INTEGRATION - Vorarlberg Online
SPRACHE BILDUNG INTEGRATION - Vorarlberg Online
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
1.2.3<br />
Rolle der Muttersprache (oder Erstsprache) 1<br />
Passiert der Erwerb der Muttersprache unter normalen Umständen<br />
völlig automatisch, wirkt sich diese doch prägend in ihrer<br />
Lautgestaltung und grammatikalischen Struktur so tief in das<br />
Bewusstsein des Kindes ein, dass im Allgemeinen etwa ab der<br />
Pubertät keine andere Sprache mehr diesen Platz einnehmen<br />
kann.<br />
Durch die Muttersprache erwirbt das Kind wichtige soziale,<br />
kommunikative, kognitive und emotionale Fähigkeiten. Mit Hilfe<br />
der Sprache entdeckt das Kind seine Welt. Über die<br />
Muttersprache ist das Kind aber auch mit seinen Eltern,<br />
Geschwistern und Verwandten verbunden und damit mit den<br />
Menschen, denen es am nächsten steht. Noch bevor das Kind<br />
selbst sprechen kann, hört es die Muttersprache, die ihm die<br />
Erfahrung von Zuwendung und Angenommensein ermöglicht<br />
und über die seine Beziehungen gestaltet werden. Gerade weil<br />
die Muttersprache eine so zentrale Rolle beim Heranwachsen des<br />
Kindes spielt, besteht auch ein enger Zusammenhang mit der<br />
Entwicklung seiner Identität. Das Selbstbild des Kindes<br />
bestimmt sich wesentlich über die Muttersprache. Zusammen mit<br />
dem Erwerb der Muttersprache erlernt das Kind außerdem<br />
Mimik, Gestik, Sprechrhythmus, Intonation und Körperbewegung.<br />
Und schließlich wird dem Kind durch die Muttersprache<br />
gesellschaftliches Wissen vermittelt. (Man begrüßt und verabschiedet<br />
sich, sagt “bitte” und “danke” etc.) Durch das Zusammenwirken<br />
all dieser Aspekte wird die Muttersprache für das<br />
Kind zu einem Stück Heimat. Sie gibt ihm Sicherheit und<br />
Orientierung. Festzuhalten bleibt also: Die Muttersprache ist von<br />
zentraler Bedeutung, weil das heranwachsende Kind durch sie<br />
alles Notwendige erlernt, um sich in dieser Welt zurechtzufinden.<br />
Es besteht ein direkter Zusammenhang zwischen der Sprachentwicklung<br />
in der Muttersprache und dem Erlernen einer Zweitsprache.<br />
In dem Bild des Sprachbaumes von Wendtlandt gesprochen,<br />
bedeutet es, dass die Wurzeln und der Stamm stark ausgeprägt<br />
sind und sich deshalb eine zweite Baumkrone entwickeln kann.<br />
In Bezug auf das Erlernen einer Zweitsprache ist ein besonderer<br />
Aspekt zu beachten: die „Interdependenz-Hypothese“ besagt,<br />
dass eine gute muttersprachliche Kompetenz förderlich für den<br />
Erwerb einer Zweitsprache ist. Bei Kindern, deren muttersprachliche<br />
Fähigkeiten weniger gut entwickelt sind, kann ein intensives<br />
Angebot in der Zweitsprache in den ersten Schuljahren zu<br />
einer Störung der Entwicklung der Muttersprache und in deren<br />
Folge auch der Zweitsprache führen. Laut Fthenakis besteht die<br />
Abhängigkeit der Zweitsprache von der Muttersprache nicht in<br />
der allgemeinen Kommunikationsfähigkeit (gängiger Wortschatz,<br />
einfache Grammatik, Aussprache), sondern im Hinblick<br />
auf die so genannte kognitv-akademische Sprachfähigkeit. Diese<br />
kognitiv-akademische Sprachfähigkeit ist nicht nur akademisch<br />
gebildeten Menschen vorbehalten. Sie bedeutet, dass die<br />
Fähigkeit entwickelt ist, Sprache als Denkinstrument zu benützen.<br />
Das Erlernen der Muttersprache prägt ein inneres Vorwissen<br />
in Bezug auf Sprache. Dieses Vorwissen scheint laut Fthenakis<br />
eine Art „vorsprachliche Denkbasis“ darzustellen, die dann für<br />
1 auszugsweise aus der Diplomarbeit “Bestandsaufnahme der aktuellen Situation<br />
von Volksschulkindern mit nichtdeutscher Muttersprache im Bundesland<br />
<strong>Vorarlberg</strong>” von Nathalie Pallavicine, 2004<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
20<br />
die Zweitsprache zur Verfügung. Bei schlechter muttersprachlicher<br />
Kompetenz ist sie unterentwickelt. Wenn aber die<br />
Muttersprache gut entwickelt ist, lässt sich auf diesem Vorwissen<br />
eine Zweit- oder Drittsprache besser aufbauen.<br />
Es ist also festzuhalten, dass gute Kenntnisse in der Muttersprache<br />
das Lernen einer Zweitsprache erleichtern. Eine positive<br />
Einstellung gegenüber der Muttersprache des Kindes wirkt sich<br />
gut auf dessen Entwicklung und auf dessen Selbstwertgefühl aus.<br />
Die Förderung beider Sprachen wirkt sich somit auch direkt auf<br />
den Erfolg in der Schule aus. Dieser Umstand stellt eine<br />
Verpflichtung dar, Kindern mit nichtdeutscher Muttersprache<br />
neben dem frühen Zugang zur deutschen Sprache auch die kontinuierliche<br />
Entwicklung ihrer Muttersprache zu ermöglichen.<br />
1.2.4<br />
Erlernen einer Zweitsprache 2<br />
Das Erlernen einer Zweitsprache kann unter sehr verschiedenen<br />
Voraussetzungen geschehen, die den jeweiligen Verlauf stark<br />
beeinflussen können.<br />
Solche verschiedenen Formen können zum Beispiel sein:<br />
Eltern mit verschiedenen Muttersprachen sprechen jeweils ihre<br />
Sprache mit dem Kind, die Elternpartner verstehen die Sprache<br />
des anderen (Vater und Mutter verkörpern jeweils ihre<br />
Muttersprache à das Kind wächst zweisprachig auf)<br />
ein Elternteil ist mit der deutschen Muttersprache aufgewachsen,<br />
ein Elternteil mit einer nichtdeutschen Muttersprache und versteht<br />
Deutsch nicht. Die gemeinsame Familiensprache ist die<br />
nichtdeutsche Sprache.<br />
beide Eltern sind mit der gleichen nichtdeutschen Muttersprache<br />
aufgewachsen und sprechen diese auch zuhause mit den Kindern<br />
beide Eltern sind mit der gleichen nichtdeutschen Muttersprache<br />
aufgewachsen, mindestens ein Elternteil kann Deutsch. Es werden<br />
beide Sprachen mit dem Kind gesprochen<br />
es besteht die Möglichkeit zwischen Sprachen hin- und her zu<br />
wechseln und beide Elternteile verstehen diese gleich gut.<br />
Für dieses Gesamtkonzept ist speziell die Gruppe besonders von<br />
Interesse, bei der beide Elternteile eine gemeinsame nichtdeutsche<br />
Muttersprache haben und diese zuhause mit den Kindern<br />
sprechen. Das heißt, man kann davon ausgehen, dass diese<br />
Kinder nicht zweisprachig aufwachsen (keine zwei gleichberechtigten<br />
Sprachen in ihrer Familie erleben und erlernen). Dadurch<br />
entsteht die klassische Situation, die ein Zweitspracherwerb notwendig<br />
macht.<br />
<strong>SPRACHE</strong><br />
<strong>BILDUNG</strong><br />
<strong>INTEGRATION</strong><br />
2 nach Heuchert 1994, zitiert in Böhm & Böhm 1999 S 167