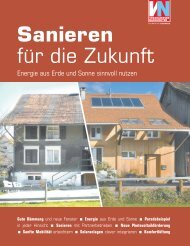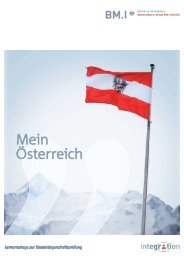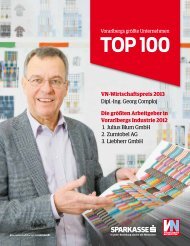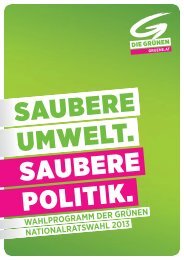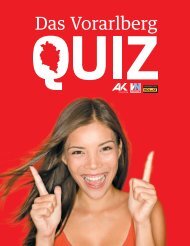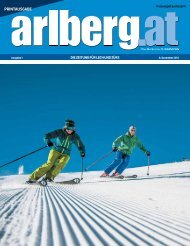SPRACHE BILDUNG INTEGRATION - Vorarlberg Online
SPRACHE BILDUNG INTEGRATION - Vorarlberg Online
SPRACHE BILDUNG INTEGRATION - Vorarlberg Online
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
1 Kapitel:<br />
Grundlagen – Einführung<br />
1.1<br />
<strong>SPRACHE</strong> - <strong>BILDUNG</strong> - <strong>INTEGRATION</strong><br />
1.1.1<br />
Sprache als Schlüssel zur Integration 1<br />
Sprache brauche ich, um mich selbst besser zu verstehen und um<br />
mich darstellen zu können. Sprache brauche ich, um Abläufe besser<br />
zu verstehen und erklären zu können. Sprache brauche ich,<br />
um den Kontakt mit anderen Menschen besser zu verstehen und<br />
um mich als soziales Wesen zu erleben. 2 Sobald Sprache als<br />
Mittel der Verständigung zwischen mindestens zwei Menschen<br />
dient, ist eine gemeinsame Sprache von großem Nutzen.<br />
In unserem Kontext des gesellschaftlichen Tuns ist Sprache sowohl<br />
Medium der alltäglichen Kommunikation als auch Ressource,<br />
insbesondere bei der Bildung und auf dem Arbeitsmarkt.<br />
Sprache oder Akzente dienen auch als Zeichen der Zusammengehörigkeit<br />
oder auch Fremdheit. Beides hat emotional erkennbare<br />
Auswirkungen.<br />
In alltäglichen Beobachtungen ist leicht festzustellen, wie sich<br />
das Verhalten von Menschen verändert, wenn sie die geläufige<br />
Sprache der anderen Leute beherrschen oder eben nicht. Die Entscheidung,<br />
wo ich einkaufe, wo ich meine Freizeit verbringe, ob<br />
ich an kulturellen Ereignissen teilnehme, wird direkt davon beeinflusst.<br />
Besonders beeinflussend scheint eine gemeinsame Sprache,<br />
wenn es gilt betriebliche Abläufe sicher zu stellen, Vereinbarungen<br />
zu treffen und Notsituationen meistern zu können.<br />
Für Menschen, die von einer Sprachwelt in eine andere einwandern,<br />
ist der Erwerb der Sprache des Einwanderungslandes<br />
gleichsam von Bedeutung, sowie die Beibehaltung der Herkunftssprache<br />
(oder eben deren Aufgabe). Der Spracherwerb der<br />
neuen Sprache hängt von mehreren Faktoren ab:<br />
- Motivation (z.B. Aussicht auf ein höheres Einkommen)<br />
- Zugang (z.B. Kontaktmöglichkeiten oder Kursangebote)<br />
- Fähigkeiten (z.B. Intelligenz oder die bereits erfahrene<br />
Lernfähigkeit von Sprachen) und<br />
-<br />
Kosten des Lernens (z. B. Zeitaufwand, Angleichungsstress,<br />
Geld)<br />
Diese Form der Sprachaneignung ist besonders relevant für Einwanderer<br />
im Jugendlichen- oder Erwachsenenalter. Für Kinder,<br />
welche in diesem Einwanderungsland bereits geboren sind oder<br />
in sehr jungen Jahren eingereist sind, sind die oben genannten<br />
Faktoren insofern bedeutsam, da sie von Seiten der Erwachsenen<br />
beeinflussbar sind.<br />
1<br />
Aus Migration, Sprache und Integration: Die AKI-Forschungsbilanz 4 kurz gefasst<br />
von Hartmut Esser, Jänner 2006, Arbeitsstelle Interkulturelle Konflikte und gesellschaftliche<br />
Integration (AKI) und Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung<br />
(WZB)<br />
2<br />
Gösse, Rose: Sprache und Spielförderung in Kindergarten und Schule.<br />
8<br />
Dieses hier vorliegende Gesamtkonzept richtet den Blick vor<br />
allem auf diese Gruppe von Menschen. Kindern mit nichtdeutscher<br />
Muttersprache, welche in Österreich aufwachsen, soll es im<br />
Vorschulalter ermöglicht werden, die Deutsche Sprache so gut zu<br />
erlernen, dass sie eine faire und hoffnungsvolle Chance für ihr<br />
weiteres Leben hier in Österreich bekommen.<br />
1.1.2 Sprache als Schlüssel zum Bildungserfolg<br />
Schulische Leistungen sind sowohl direkt als auch indirekt an<br />
sprachliche Kompetenzen gebunden. Entscheidend sind dabei<br />
heute fast ausschließlich Kompetenzen in der Landes- und<br />
Unterrichtssprache. Dass Kinder mit nichtdeutscher Muttersprache<br />
nach dem Pflichtschulbesuch von österreichischen Schulen<br />
einem hohen Bildungsunterschied unterworfen sind, zeigt sich in<br />
mehrfacher Weise. Zum einen haben die Ergebnisse von PISA<br />
2003 aufgezeigt und bestätigt, dass Kinder/Jugendliche mit Migrationshintergrund<br />
(Jugendliche der 1. Generation = im Inland<br />
geborene Kinder von im Ausland geborenen Eltern und Jugendliche,<br />
die wie ihre Eltern im Ausland geboren wurden) deutlich<br />
schwächer abschneiden als einheimische Kinder (Kinder, die in<br />
Österreich geboren wurden und von denen zumindest ein Elternteil<br />
in Österreich geboren wurde). Und zum anderen zeigt ein<br />
Vergleich der Präsenz von Jugendlichen mit Migrationshintergrund<br />
in den Schulen nach der Pflichtschulzeit, wie deutlich niedriger<br />
ihr Anteil ist – oder anders formuliert, wie selten es Jugendlichen<br />
mit Migrationshintergrund gelingt, eine höhere bzw.<br />
weiterführende Schule zu besuchen und dadurch eine zukunftsträchtige<br />
Bildung zu erlangen. Dieser Umstand ist umso bedeutsamer,<br />
wenn aus Sicht der einheimischen Wirtschaftsbetriebe ein<br />
akuter Facharbeitermangel vorherrscht und dieser in den nächsten<br />
Jahren sich noch deutlicher verschärfen wird.<br />
1.1.2.1<br />
Pisa 2003 3<br />
Im internationalen Vergleich belegt Österreich mit einem Mittelwert<br />
von 506 Punkten den 15. Rang und liegt somit im OECD-<br />
Durchschnitt (ähnlich wie Frankreich (511), Schweden (509),<br />
Deutschland (503), Slowakei (498) oder Norwegen (495).<br />
Allerdings ist der Abstand zu den Spitzenländern beträchtlich<br />
und signifikant. Hongkong (550), Finnland (544) und Korea<br />
(542) sind Österreich weit voraus. Besonders interessant ist der<br />
Vergleich mit den Niederlanden (538), Belgien (529) und der<br />
Schweiz (527), da diese Länder vergleichbare Strukturen im Bildungswesen<br />
betreiben.<br />
Faktor Migration<br />
Mathematik Lesen Naturwissenschaft<br />
Einheimische Jungendliche<br />
(86,7 %) 515 501 502<br />
1. Generation (4,1 %) 459 428 435<br />
Im Ausland geborene<br />
SchülerInnen 452 425 422<br />
3<br />
aus Zusammenfassung wichtiger Ergebnisse der internationalen Bildungsstudie<br />
PISA 2003 – mit dem Fokus auf das Abschneiden der SchülerInnen migrantischer<br />
Herkunft von Simon Burtscher, okay.zusammenleben