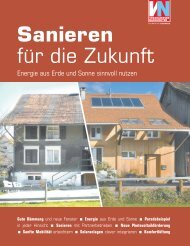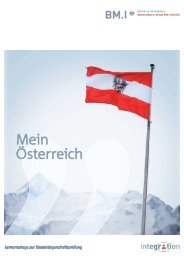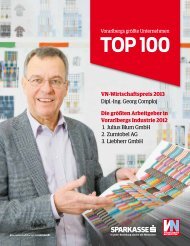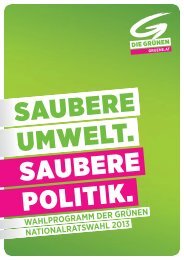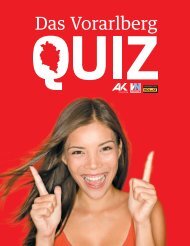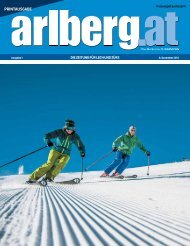SPRACHE BILDUNG INTEGRATION - Vorarlberg Online
SPRACHE BILDUNG INTEGRATION - Vorarlberg Online
SPRACHE BILDUNG INTEGRATION - Vorarlberg Online
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
3. Kapitel<br />
„Fördern und Fordern“<br />
Das Gesamtkonzept zur Frühen Sprachförderung im Vorschulalter<br />
hat ein klares Ziel. Auch Kinder mit nichtdeutscher Muttersprache<br />
sollen bis zum Zeitpunkt der Einschulung die deutsche<br />
Sprache so gut beherrschen, dass sie dem Unterricht von Anfang<br />
an gut folgen können. Außerdem soll betont werden, dass die<br />
pädagogische Ausrichtung zur Mehrsprachigkeit in den pädagogischen<br />
Einrichtungen eine wünschenswerte Entwicklung ist.<br />
Wenn das Ziel erreicht werden soll, dass alle Kinder mit nichtdeutscher<br />
Muttersprache genügend Deutschkenntnisse in die<br />
Schule mitbringen, dass sie den deutschsprachigen Unterricht<br />
verstehen, müssen klare und verbindliche Vereinbarungen getroffen<br />
werden. Vereinbarungen an denen alle Betroffenen beteiligt<br />
sind.<br />
Verbindlichkeit in den Vereinbarungen bedeutet auch, dass sich<br />
die Beteiligten gegenseitig unterstützen und Vertragstreue mit<br />
einbringen – ein ausgewogenes Geben und Nehmen ist selbstverständlich.<br />
Ein gezieltes Betrachten, welche Wirkung die gesetzten<br />
Maßnahmen gezeigt haben, ist wünschenswert und notwendig.<br />
So kann eine selbstlernende Bewegung entstehen.<br />
Beteiligte dieses Kontraktes sind<br />
KINDER – ELTERN – PÄDAGOGINNEN –<br />
EINRICHTUNGEN<br />
Bei jeder dieser Beteiligtengruppen soll nun im nachfolgenden<br />
Teil festgehalten werden, welche Vereinbarungen und<br />
Zielsetzung notwendig sind, dass das oben genannte Ziel erreicht<br />
werden kann. Dabei werden zwei Kategorien unterschieden:<br />
„Was ist wünschenswert?“ und „Was ist notwendig?“. Weiters<br />
sollen Möglichkeiten aufgezeigt werden, wie diese gesetzten<br />
Ziele strukturell unterstützt werden können.<br />
3.1<br />
KINDER MIT NICHTDEUTSCHER<br />
MUTTER<strong>SPRACHE</strong><br />
Ziel: Alle Kinder mit nichtdeutscher Muttersprache können bis<br />
zum regulären Schuleintritt so gut Deutsch, dass sie dem Unterricht<br />
in der deutschen Sprache problemlos folgen können und<br />
somit ihrer Begabung entsprechen einen erfolgreichen Bildungsweg<br />
vor sich haben.<br />
3.1.1<br />
Kinder von 0 bis 3 Jahre:<br />
Wünschenswert:<br />
Kinder finden von Geburt an ein sprachanregendes Umfeld vor.<br />
Die Eltern sind sich ihrer Aufgabe bewusst, wie wichtig eine<br />
gesicherte Erstsprache für den Erwerb einer Zweitsprache ist.<br />
Kinder erleben es als selbstverständlich, dass sie in einer mehrsprachigen<br />
Gesellschaft aufwachsen und erleben es als positiv,<br />
die Muttersprache und Deutsch als Zweitsprache zu beherrschen.<br />
Kinder bekommen schon in frühen Jahren (1 bis 3 Jahre) alltäglichen<br />
Kontakt zu Kindern mit deutscher Muttersprache.<br />
Kinder bekommen die Möglichkeit noch vor dem Kindergarten<br />
Gruppenerfahrungen zu machen und erleben in diesen Gruppen<br />
eine pädagogisch bewusst gelebte Mehrsprachigkeit.<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
36<br />
Notwendig:<br />
Kinder werden vor allem medizinisch darauf hin untersucht,<br />
dass alle Sinnesorgane und sonstigen körperlichen Entwicklungen,<br />
die für einen normalen Spracherwerb notwendig sind, sich<br />
altersgemäß entwickeln<br />
Eine gesicherte Sprachentwicklung in der Muttersprache wird<br />
von einer Fachperson von außen wahrgenommen – falls notwendig,<br />
bekommen die Eltern Unterstützung<br />
strukturelle Unterstützung:<br />
Die bewusste und gezielte Unterstützung der Eltern erfolgt auf<br />
Basis einer verbindlichen Kontaktaufnahme durch dafür geschulte<br />
Personen. „Brückenbauerinnen“ nehmen von sich aus<br />
Kontakt zu den jeweiligen Familien auf. Eine Verknüpfung mit<br />
den medizinisch ausgerichteten Mutter-Kind-Pass Terminen ist<br />
gut vorstellbar.<br />
Damit Kinder in diesem Alter vermehrt Gruppenerfahrungen<br />
machen können, ist es notwendig, dass bestehende Einrichtungen<br />
(Spielgruppen und Kleinkindbetreuungen) sich bewusster<br />
auf diese Nutzergruppe vorbereiten und ihr Angebot in diese<br />
Richtung weiter entwickeln. Dies soll von kompetenter Landesstelle<br />
begleitet und forciert werden.<br />
Die Gründung von muttersprachlich ausgerichteten Spielgruppen<br />
mit einem gezielten Angebot für Deutsch als Zweitsprache<br />
ist wünschenwert.<br />
3.1.2<br />
Kinder von 3 bis 6 Jahren:<br />
Wünschenswert:<br />
Kinder knüpfen alltägliche Kontakte (in Gruppen und privat)<br />
mit Kindern deutscher Muttersprache<br />
Kinder erleben sich in einer Atmosphäre, die eine gesicherte<br />
Entwicklung ihrer Erst- und Zweitsprache zulassen<br />
Notwendig:<br />
Kinder erfahren eine verbindliche und regelmäßige<br />
Sprachförderung in einer dafür ausgebildeten und ausgestatteten<br />
pädagogischen Einrichtung. (Die Träger von Kindergärten achten<br />
darauf, dass Kinder mit nichtdeutscher Muttersprache sicher<br />
den Kindergarten besuchen).<br />
Kinder nehmen verbindlich an den angebotenen<br />
Sprachfördermaßnahmen teil.<br />
Kinder erleben eine aktive Zusammenarbeit von Kindergarten<br />
und Elternhaus in dem es sieht, dass Informationen ausgetauscht<br />
werden und die Eltern sich aktiv in den<br />
Sprachförderprozess einbringen.<br />
Eine muttersprachliche Sprachstandfeststellung erfolgt verbindlich<br />
beim Eintritt in den Kindergarten und wird den Eltern rükkgemeldet.<br />
Falls notwendig, wird ihnen Unterstützung in der<br />
gezielten Weiterentwicklung der muttersprach-lichen Fähigkeit<br />
ihres Kindes gegeben.<br />
Eine Sprachstandbeobachtung in Bezug auf die<br />
Sprachentwicklung in der deutschen Sprache wird vom<br />
Kindergartenpersonal zweimal pro Jahr durchgeführt.<br />
Wenn es notwendig erscheint, soll eine externe spezialisierte<br />
Förderung einmal pro Woche dem Kind Unterstützung bieten.<br />
Strukturelle Unterstützung:<br />
siehe Eltern und Pädagogik.