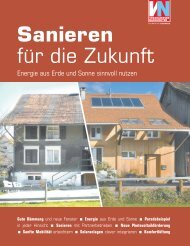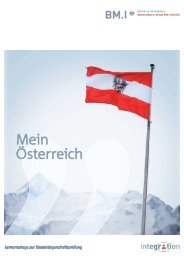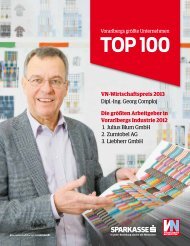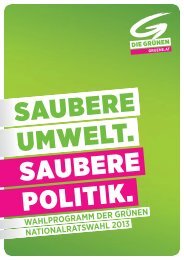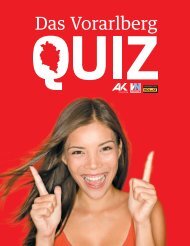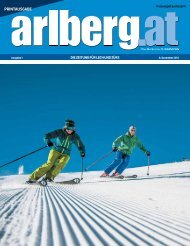SPRACHE BILDUNG INTEGRATION - Vorarlberg Online
SPRACHE BILDUNG INTEGRATION - Vorarlberg Online
SPRACHE BILDUNG INTEGRATION - Vorarlberg Online
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
2.2.5<br />
Fazit<br />
Grundsätzlich wird diese Mehrbeachtung der Sprachförderung<br />
von allen Beteiligten als besonders wichtig und richtig betrachtet.<br />
Defizite erkennen und durch Förderung antworten ist ein wichtiger<br />
und kluger Weg. Der Kindergarten kommt durch das Thema<br />
der Sprachförderung in eine neue Rolle. Früher im Bereich des<br />
Bildungsweges eher wenig beachtet, rückt diese Einrichtungsebene<br />
immer mehr in den Mittelpunkt der öffentlichen Wahrnehmung.<br />
Diese neue Sensibilität ist eine große Chance für die Kiga-<br />
Einrichtungen – aber auch eine Verantwortung.<br />
Für die Weiterentwicklung des Sprachtickets oder der Sprachförderung<br />
sollten folgende Fragen geklärt werden:<br />
die Sprachstandfeststellungen sind sehr wesentlich<br />
- Wer soll sie durchführen? (Schulleitung, Kiga-Personal)<br />
- Ist eine Objektivierung der Entscheidung möglich?<br />
- Ist eine fachlich fundiertere Form notwendig?<br />
- Wer braucht die Informationen und die daraus ableitbaren<br />
Schlüsse?<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
Ist die Inanspruchnahme des Sprachtickets tatsächlich freiwillig<br />
zu halten?<br />
die Notwendigkeit einer Sprachförderung ist ein zu wesentliches<br />
Ereignis, als dass eventuelle Unachtsamkeiten oder subjektiv<br />
anders eingeschätzte Fähigkeiten des Kindes durch die<br />
Eltern blockiert werden können. (in <strong>Vorarlberg</strong> 2006/07 wurden<br />
60 ausgestellte Sprachtickets nicht eingelöst)<br />
Unterstützung durch externe Personen<br />
Wer sind die externen Personen? Welche Befähigungen bringen<br />
sie mit? Welche Befähigung sollen sie bekommen?<br />
Zusammenarbeit mit den Stammpersonal der Gruppe und klarer<br />
Auftrag, wer welche Rolle inne hat<br />
Hilft diese externe Person den betroffenen Kindern oder verunsichert<br />
es sie?<br />
Wird die Methode der Sprachförderung dadurch automatisch<br />
verschult und defizitorientiert?<br />
Wie können die Informationen zum Sprachticket und zur<br />
Sprachförderung treffsicherer werden?<br />
- Infos an die Gemeinden<br />
- an die Eltern<br />
- zwischen Schule und Kiga<br />
-<br />
-<br />
Wie gehen wir mit dem entstehenden Erwartungsdruck um?<br />
die Erwartungshaltung der Eltern wurde durch die Form des<br />
Tickets enorm hoch geschraubt. Was ist real machbar? Wer sind<br />
die Beteiligten in diesem Programm?<br />
Gibt es Erwartungen von der Schule an den Kindergarten?<br />
Finanzprobleme und monetäre Bewertung der Sprachförderung<br />
die Euro 80,- pro Kind sind als symbolische Größe anzusehen.<br />
Manche Träger sehen dies als Provokation an. Das Land Salzburg<br />
hat eine interne Berechnung angestellt und kommt dabei<br />
auf Euro 400,- pro Kind. Die Stadt Recklinghausen ist unabhängig<br />
in ihrer Kalkulation auf Euro 430,- pro Kind und Jahr gekommen.<br />
Das Bundesland Nordrhein-Westfalen hat angekündigt, den<br />
Aufwand mit Euro 350,- pro Kind und Jahr bedecken zu wollen.<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
-<br />
32<br />
Die Ausstellung des Sprachtickets (durch ein Sprachstandsfeststellungsverfahren)<br />
ist von der Anzahl her mit sehr unterschiedlichen<br />
Kosten für die Träger verbunden. Ob externe<br />
Unterstützungskräfte gebraucht werden oder nicht, ist mit direkten<br />
zusätzlichen Kosten verbunden, die meist nicht eingeplant<br />
und budgetiert wurden.<br />
Zeitpunkt des Sprachtickets<br />
das Ticket schon für 3 jährige Kinder zu ermöglichen, ist fachlich<br />
gesehen als unbedingte Verbesserung anzusehen und<br />
erleichtert die stressfreie Handhabe des Sprachtickets<br />
Rahmenbedingungen in den Gruppen<br />
Gruppengröße<br />
Anteil von Kindern mit nichtdeutscher Muttersprache in der<br />
Gruppe<br />
Personalschlüssel und deren Qualifikation<br />
Vorhandensein einer externen Fachkraft<br />
muttersprachliche Unterstützung<br />
Fachliche Voraussetzungen des pädagogischen Personals<br />
je nach Grad der Betroffenheit soll eine stetige Weiterqualifizierung<br />
stattfinden<br />
das Kennenlernen von neuen Methoden, Materialien und<br />
Dokumentationsmitteln ist als Grundstandard zu definieren<br />
deren Anwendung als pädagogischer Standard zu verstehen<br />
auch einheimische Kinder sollen gefördert werden<br />
-<br />
die Kombination vom VBB (<strong>Vorarlberg</strong>er Beobachtungsbogen)<br />
und Sprachförderung ab 4 Jahre bietet sich an, dass alle Kinder<br />
auch die mit deutscher Muttersprache aufmerksam und bewusst<br />
mit eingebunden werden.<br />
2.3<br />
GEMEINDEINITIATIVEN<br />
In Sachen Sprachförderungen<br />
Schon lange vor dem vom Bund installierten „Sprachticket“ haben<br />
einige Kommunen in <strong>Vorarlberg</strong> sich dem Thema Sprachförderung<br />
für Kinder mit nichtdeutscher Muttersprache intensiv<br />
zugewandt. Einige solcher Projekte sollen hier kurz erwähnt werden<br />
(ohne Anspruch auf Vollständigkeit):<br />
Dornbirn hat schon im Oktober 2002 in Zusammenarbeit mit<br />
„b a s e“ (Büro für angewandte Sozialforschung Basel) ein<br />
Integrationsleitbild mit Maßnahmenkatalog erstellt. Einer von<br />
drei Leitsätzen lautet: „Integrationspolitik setzt nicht symptomorientiert<br />
oder defizitverwaltend, sondern präventiv, ursachenbezogen<br />
sowie „fördernd und fordernd“ im Sinne der Entfaltung<br />
des menschlichen Potentials an.“ Logisch abgeleitet ergibt dies<br />
ein bewusstes Zugehen auf Sprachfördermaßnahmen: „Der<br />
Erwerb und die Förderung von Sprachkompetenzen (fundierte<br />
Mehrsprachigkeit) ist ein wichtiger Pfeiler für die schulische<br />
Integration, da durch die Aufwertung von Mehrsprachigkeit das<br />
bestehende Potenzial genutzt, der Deutscherwerb erleichtert und<br />
gleichzeitig die soziale Integration sowie das paritätische<br />
Zusammenleben gefördert wird.“