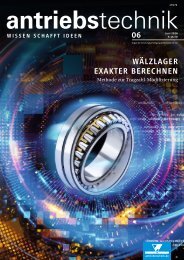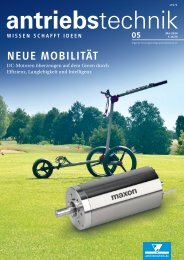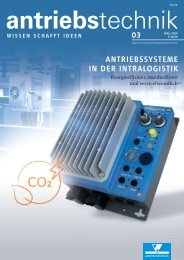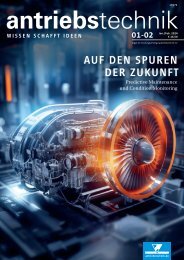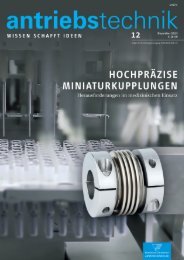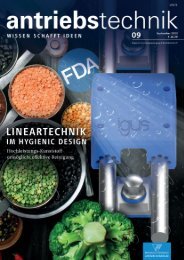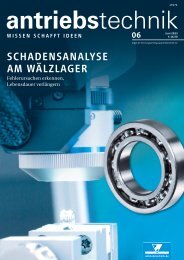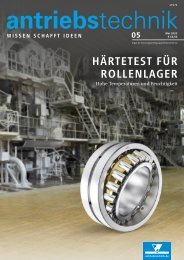antriebstechnik 10/2016
antriebstechnik 10/2016
antriebstechnik 10/2016
- TAGS
- antriebstechnik
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
08 Simulationsergebnisse des Vergleichs zwischen<br />
SMDS-Getriebe und MMDS-Sammelgetriebe<br />
des Prüfstandantriebssystems mit vier identischen Motoren mit<br />
jeweils 35 Nm Nenndrehmoment angenommen. Weiterhin wurde<br />
angenommen, dass in Abhängigkeit des erforderlichen Antriebsdrehmoments<br />
die vier Motoren sukzessive zugeschaltet werden<br />
und die jeweiligen Einzelantriebsstränge bis zum Zeitpunkt der<br />
Motoreinschaltung mechanisch vollständig durch ein Schieberadkonzept<br />
von dem Sammelrad des Getriebes entkoppelt sind. Der<br />
sich für diese Betriebssituation bei der Nenndrehzahl des Getriebes<br />
ergebende Getriebewirkungsgrad ist in Bild 09 dargestellt. Zusätzlich<br />
sind die Wirkungsgrade des MMDS-Sammelgetriebes ohne<br />
Berücksichtigung der mechanischen Rekonfigurierbarkeit sowie<br />
der SMDS-Getriebewirkungsgrad abgebildet.<br />
Durch die Nutzung der mechanischen Rekonfigurierbarkeit lässt<br />
sich eine Verbesserung des MMDS-Sammelgetriebewirkungsgrades<br />
im Teillastbereich erzielen. Gegenüber dem leistungsäquivalenten<br />
SMDS-Getriebe konnte hier eine maximale Wirkungsgradsteigerung<br />
um 2,8 % erreicht werden. Dieses Wirkungsgradverhalten ist auf die<br />
Vermeidung der lastunabhängigen Verlustanteile der mechanisch<br />
entkoppelten Wellen des MMDS zurückzuführen. Sobald der Drehmomentbedarf<br />
die Zuschaltung eines weiteren Motors erfordert,<br />
fallen diese Verlustanteile jedoch wieder in voller Höhe an, wodurch<br />
sich der stufenförmige Verlauf des Wirkungsgrades im Bereich<br />
der Motornenndrehmomentgrenzen bei 35 Nm, 70 Nm und<br />
<strong>10</strong>5 Nm erklärt.<br />
Es ist allerdings zu beachten, dass durch die sukzessive Zuschaltung<br />
das antriebsseitige Drehmoment asymmetrisch auf die vier<br />
Zahneingriffsstellen des Sammelrades verteilt wird. Somit liegt eine<br />
Kraftkompensation nur bedingt vor, wodurch die Lagerbelastung<br />
an der Abtriebswelle gegenüber einer symmetrischen Drehmomentverteilung<br />
ansteigt. Weiterhin kann eine ungünstige Zuschaltreihenfolge<br />
dazu führen, dass die Kraftkompensation bei zwei<br />
aktiven Motoren nicht genutzt wird, was zu gesteigerten lastabhängigen<br />
Lagerverlusten über den gesamten Drehmomentbereich<br />
bis zum Nenndrehmoment führt (Bild 09 unten). Dieser Verlustanteil<br />
ist jedoch geringer als der Anteil der lastunabhängigen Lagerund<br />
Verzahnungsverluste. Folglich kann der Gesamtwirkungsgrad<br />
des Getriebes auch bei Nichtbeachtung der Zuschaltreihenfolge<br />
und dementsprechend einer asymmetrischer Drehmomentverteilung<br />
verbessert werden.<br />
Im weiteren Verlauf der Forschungsarbeiten wird untersucht werden,<br />
auf welche Weise eine möglichst symmetrische Drehmomentverteilung<br />
bei Nutzung der mechanischen Rekonfigurierbarkeit<br />
realisiert werden kann. Zu beachten ist in diesem Zusammenhang,<br />
dass weitere Bestandteile einer intelligenten Betriebsstrategie – wie<br />
beispielsweise die elektrische Rekonfigurierbarkeit (siehe Beitrag 1<br />
und Beitrag 3 der Artikelserie) – anders geartete Drehmomentverteilungen<br />
bevorzugen oder erfordern können. Ziel muss es sein,<br />
einen Kompromiss zu finden, sodass die Effizienz des Gesamtsystems<br />
ein globales Wirkungsgradoptimum erreicht. Einen weiteren<br />
Schwerpunkt der Forschungsarbeiten stellt die technische Realisierung<br />
der automatisierten Nutzung der mechanischen Rekonfigurierbarkeit<br />
dar. In diesem Themenfeld werden unterschiedliche<br />
Schaltaktorikkonzepte und deren Integration in eine intelligente<br />
Betriebsstrategie untersucht werden.<br />
Modellbasierter Vergleich<br />
Im Folgenden wird unter Verwendung des aus dem ersten Beitrag<br />
bekannten Arbeitsprozesses des Kautschukinnenmischers gezeigt,<br />
welches Effizienzsteigerungspotential ein MMDS-Sammelgetriebe<br />
gegenüber einem konventionellen Getriebekonzept besitzt. Hierzu<br />
wurde der Arbeitsprozess auf das Antriebssystem des Prüfstands<br />
skaliert, so dass die Nennleistungsauslastung mit der realen<br />
Produktionsanlage übereinstimmt. Mit Hilfe des Simulationsmodells<br />
wurden die Verlustleistungen des SMDS-Getriebes und des MMDS-<br />
Getriebes berechnet. Für das MMDS wurden eine Antriebssystemkonfiguration<br />
mit vier identischen Motoren und die durchgängige<br />
Nutzung der mechanischen Rekonfigurierbarkeit mit einer sukzessiven<br />
Aufteilung des erforderlichen Antriebsdrehmoments angenommen.<br />
Die mechanische Entkopplung und erneute Einkopplung der<br />
Einzelantriebsstränge wurde idealisiert ohne ein Zeitverhalten der<br />
Schaltaktorik betrachtet. Bild <strong>10</strong> zeigt in den oberen beiden<br />
112 <strong>antriebstechnik</strong> <strong>10</strong>/<strong>2016</strong>