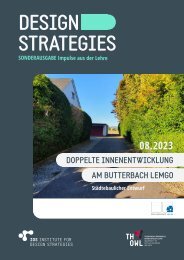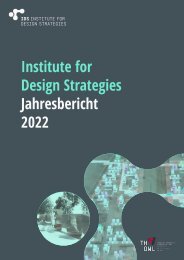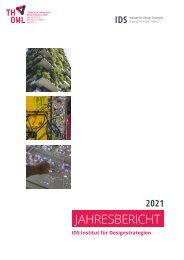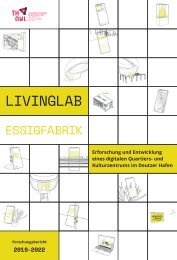urbanLab Magazin IMPULSE 08/2020 - Heimatwerker*innen
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Thorsten Dettmer<br />
134<br />
ZUSAMMENFASSUNG<br />
Mehr Innovation, weniger Integration<br />
Das urbane Potential globaler Migration<br />
Abstract<br />
Mit globaler Migration kommen internationale Erfahrung<br />
und Impulse in urbane Räume, die es zu aktivieren<br />
gilt und nicht zu unterdrücken. Planung spielt<br />
hierfür die Schlüsselrolle. Durch verantwortungsvolle<br />
Investitionen in dieses soziale Kapital könnten sich<br />
Städte und in Folge die Gesellschaft von innen heraus<br />
besser anpassen an eine sich verändernde Welt. Im<br />
Zuge urbaner Internationalität ist auch das deutsche<br />
Selbstverständnis reformbedürftig. Es stellt sich weniger<br />
die Frage nach der richtigen Integration von<br />
Zuwanderern, sondern nach einer gesellschaftlichen<br />
Innovation mit Zuwanderern.<br />
In der Theorie<br />
Wie Dreijährige im Sandkasten ihre Spielzeuge verteidigen<br />
die reichen Länder ihren Wohlstand, Sicherheit<br />
und Grundrechte gegenüber den ärmeren. Internationale<br />
Verflechtungen reicher Industrienationen haben<br />
globale Auswirkungen auf schwächere Nationen<br />
(Harvey, 2007; 2013; Sassen, 2001; 2006; Brenner,<br />
2011; Purcell, 2003; 2009).<br />
Anstelle eines wahrlich globalen Systems, welches<br />
die Schwächeren stärken würde, wächst die Ungleichheit<br />
im globalen Kapitalismus. Weder im Sandkasten<br />
noch in einer schrumpfenden Welt (Harvey,<br />
2007) bleibt solch Ungleichheit unbemerkt. Medien,<br />
soziale Netzwerke und Mobilität haben ihren Beitrag<br />
zu einer zugänglicheren Welt geleistet. Globale Ungerechtigkeit<br />
wird hinterfragt, und Bewegungsmöglichkeiten<br />
bieten sich. Dass globale Ungleichheit Migration<br />
auslöst, schürt in der reichen Welt Verlustängste.<br />
Die alte Polarität der „Push and Pull“-Faktoren verschwimmt;<br />
Menschen flüchten nicht nur, sondern<br />
haben auch Ziele. Das ist nur rational – wir würden<br />
ebenso handeln. Etwas fällt dabei auf: Wo früher eine<br />
allgemeine Migration von Ursprungs- zu Ankunftsländern<br />
stattfand, zeichnet sich heute eine Migration<br />
aus einer steigenden Anzahl von Ursprungsländern<br />
in eine schrumpfende Zahl von Ankunftsstädten ab<br />
(Czaika & de Haas, 2014; Saunders, 2018).<br />
Globale Migration ist somit ein urbanes Thema<br />
geworden.<br />
Die mit Abstand größte Gruppe globaler Migranten<br />
stellen qualifizierte junge Arbeiter aus Entwicklungsländern<br />
(Czaika & de Haas, 2014) – ein Weltmarkt, aus<br />
dem sich Deutschland bislang erfolgreich herausgehalten<br />
hat.Ein kurzer Blick in den Spiegel rückt die<br />
deutsche Sicht auf Migranten ins rechte Licht. Das<br />
deutsche Volk definiert sich in der Verfassung per Ius<br />
Sanguinis: Deutsches Blut. Schauen wir weit genug<br />
zurück, entflechten sich die Wurzeln des deutschen<br />
Stammbaumes in dutzende Völker, die durch das<br />
Machtvakuum des verfallenden Römischen Reiches<br />
streiften. Mitteleuropa blieb auch die nächsten Tausend<br />
Jahre ein Flickenteppich territorialer Ansprüche<br />
sich bekämpfender Gruppen, aber von „deutschem“<br />
Blut weiterhin keine Spur. Die germanischen Völker<br />
und diversen Königreiche, Länder und Fürstentümer<br />
sahen sich kaum als Einheit, bestenfalls im gemeinsamen<br />
Interesse, die Römer oder andere Mächte<br />
zurückzudrängen (Rosenstock, 1970; Liebesschuetz,<br />
2015). Was sie verband, waren Krieg und Leid. So<br />
kam Eugen Rosenstock bei seiner Suche nach den<br />
deutschen Ursprüngen zur nüchternen Feststellung:<br />
„Kriegsgemeinschaft hat das deutsche Volk geschaffen“<br />
(Rosenstock, 1970: 101). Luthers Bibelübersetzung<br />
war Geburtshilfe für die deutsche Sprache und<br />
die deutsche Aufklärung gründete eine Kulturnation<br />
der Dichter und Denker lange bevor unter Bismarck<br />
eine Staatsnation gebildet wurde. Die verschiedenen<br />
Fragmente bildeten ein Amalgam. „Deutschsein“<br />
musste erlernt werden und war seit jeher die Vereinheitlichung<br />
von Unterschieden (Münch, 2001).<br />
Binnen einer Generation zerbarsten dann die Konstrukte<br />
des deutschen Kaiserreiches, der Weimarer<br />
Republik und Nazideutschlands mit ihren jeweils verheerenden<br />
Folgen. Während sich die Alliierten noch<br />
gar nicht so sicher waren, ob diese Deutschen jemals<br />
wieder ein Land haben sollten, gelang den akademischen<br />
Urvätern unserer BRD (Eucken, Röpke und<br />
Rüstow) ihr ordoliberaler Geniestreich: Nicht unbedingt<br />
einen Nationalstaat sollten die Deutschen haben,<br />
sondern in erster Linie einen freien Wirtschaftsraum,<br />
in dem sie ihr Land aufbauen und sich selbst<br />
versorgen könnten (Foucault & Senellart, 20<strong>08</strong>, Bonefeld,<br />
2012).<br />
Diese Marktwirtschaft brauchte selbstverständlich<br />
Regeln und Schutz, gewährleistet durch ein staatliches<br />
Rahmenkonstrukt. Über die Aufrechterhaltung<br />
des Wirtschaftsraumes durch indirektes Agieren und<br />
Kontrollieren hinaus war eine wesentliche Aufgabe<br />
dieses Staates die Verwirtschaftlichung der Gesellschaft.<br />
Nicht umsonst wurde Müller-Armacks Begriff<br />
„soziale Marktwirtschaft“ von Hayek als irreführend<br />
kritisiert, da er die Idee von sozialer Gerechtigkeit<br />
als Gegenteil einer freien Marktwirtschaft impliziert<br />
(Hayek, 1979).