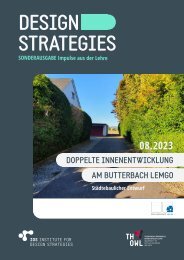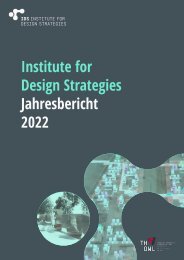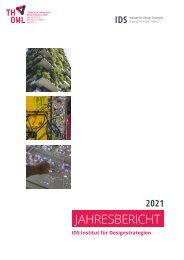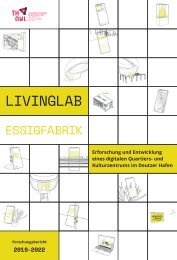urbanLab Magazin IMPULSE 08/2020 - Heimatwerker*innen
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Eine zu befürchtende Systemkritik durch das Proletariat<br />
wurde umgangen, indem aus der bisherigen Arbeiterklasse<br />
„kleinen Kapitalisten“ gemacht wurden,<br />
die ihre Arbeitskraft zu Markte tragen, um eventuell<br />
auch einmal Aktien oder ein Haus besitzen zu können<br />
(Röpke, 1950). Der soziale Zusammenhalt dieser auf<br />
Konkurrenz basierenden Gesellschaft sollte allein<br />
„von unten“ entstehen durch Familie, Freundeskreis<br />
und Kollegen. Für alles andere, etwa eine nationale<br />
Idee war das Misstrauen der Beteiligten, von den Alliierten<br />
über die Urväter bis hin zum Volk selbst, zu<br />
groß. Ich will hier gar nicht weiter auf die Entstehung<br />
des modernen Deutschlands eingehen, außer festzustellen,<br />
dass die Deutschen eine schwere Geburt<br />
hatten (siehe hierzu auch Lorch, 2017; Zweynert,<br />
2013; Biebricher, 2011; Bonefeld, 2012; Somma, 2013;<br />
Kurthen, 1995; Oliver, 1960; Hall & Soskice, 2001;<br />
Foucault & Senellart, 20<strong>08</strong>).<br />
Die deutsche Identität, wenn es sie nun gibt, ist<br />
historisch stark gefärbt durch Krieg und Leid, gesellschaftlich<br />
durch homogenisierende Bildung<br />
und Kultur und in moderner Zeit durch wirtschaftliche<br />
und gesellschaftliche Konkurrenz.<br />
Dies ist einerseits als Basis für eine weltoffene Einwanderungsgesellschaft<br />
etwas dürftig. Es erklärt<br />
aber, warum die Deutschen sich damit so schwertun,<br />
mussten sie sich schließlich auch selbst stets zusammenraffen.<br />
Andererseits ist die Aufnahme Anderer<br />
und kulturelles (Er)Lernen ebenso Teil der deutschen<br />
Gesellschaft. Es ist eine Frage der Einstellung, in welche<br />
Richtung sich die Gesellschaft entwickelt. Ein Immigrationsland<br />
war die BRD schon immer, eingestanden<br />
hat sie es sich jedoch nie und tut sich weiterhin<br />
schwer damit.<br />
Einwanderungswellen gab es einige, von den Kriegsvertriebenen<br />
über die Gastarbeiter, zu den Geflüchteten<br />
aus dem Ostblock, dem Balkan, anderen<br />
Krisenherden und schließlich aus Syrien. Man teilte<br />
notgedrungen den Sandkasten (weil so in der Verfassung<br />
verankert), nicht aber das kleinkapitalistische<br />
Spielzeug. Migranten durften zugucken, aber nicht<br />
mitspielen – sie würden ja sowieso nicht bleiben<br />
(Kurthen, 1995; Schuster, 2003; Senellart & Foucault,<br />
20<strong>08</strong>). Zuwanderer wurden als wirtschaftliche Bürde<br />
betrachtet, als soziales Problem und vermutlich<br />
auch als Bedrohung für eine schwächelnde deutsche<br />
Identität. Man war misstrauisch gegenüber fremden<br />
Gebräuchen und Religionen und behandelte Migranten<br />
jahrzehntelang mit ignoranter Überlegenheit. Inzwischen<br />
haben 25% der Bevölkerung und fast 40%<br />
der Kinder einen „Migrationshintergrund“ (destatis,<br />
2017), oder sagen wir lieber „internationale Erfahrung“<br />
(El-Mafaalani, 2018), etwas womit die Deutschen<br />
historisch gesehen nicht gerade brillieren.<br />
Die sogenannte „Flüchtlingskrise“ hat unter<br />
Deutschen eine Integrationsdebatte losgetreten,<br />
wie es keine vorherige Einwanderungswelle geschafft<br />
hat.<br />
Es gibt nun zwei Möglichkeiten, mit Zuwanderung<br />
umzugehen. Zum einen können Migranten möglichst<br />
schnell eingedeutscht werden – Assimilation.<br />
Dieser Weg des Deutschwerdens ist den Deutschen<br />
schließlich historisch vertraut: Anpassen,<br />
Klappe halten, hinten anstellen (siehe auch Esser,<br />
2009). Dieser Weg ist aber ein gesellschaftlicher<br />
Holzweg. Er bringt keine neuen Erfahrungen oder<br />
Erkenntnisse und auch die gesellschaftliche Entwicklung<br />
nicht voran. Auch im internationalen<br />
Vergleich bietet er Deutschland keinerlei Vorteile,<br />
sondern ist ein Rückzug in eine nationale Ebene,<br />
die global zunehmend an Bedeutung verliert (Sassen,<br />
2001; Brenner, 2011; Robertson, 1994; 1995).<br />
Zum anderen kann sich Deutschland gesellschaftlich<br />
öffnen: schauen wir doch erstmal, was die<br />
Zuwanderer so mitbringen an Lebenserfahrung<br />
aus der großen weiten Welt. Es ist bestimmt etwas<br />
dabei, das die deutsche Welt erweitert und<br />
einen Mehrwert bildet. Der bessere Weg führt<br />
über eine ergebnisoffene Selbstfindung zur Revision<br />
des deutschen Selbstverständnisses: nicht<br />
inert, nicht hybrid, sondern genuin (Kuppinger,<br />
2014). Mit einer solchen Diskussion könnte sich<br />
Deutschland auch international besser positionieren,<br />
denn nicht nur Deutschland ändert sich,<br />
sondern Migration und diverse Gesellschaften<br />
sind ein globales Thema. Eine offene und diverse<br />
Gesellschaft hat bessere Zukunftsaussichten in<br />
einer globalisierenden Welt als Nationalnostalgie,<br />
Schließung und Schuldzuweisungen (Gaitanides,<br />
2011; 2012).<br />
Aladin el Mafaalani (2018) beschreibt sehr eindrücklich,<br />
wieviel sich in jüngster Zeit verbessert<br />
hat Hinsichtlich der Emanzipation von Minderheiten<br />
und dass das konstruktive Austragen von<br />
Konflikten kein Zeichen des sozialen Scheiterns,<br />
sondern des Gelingens einer Gesellschaft ist, die<br />
sich öffnet und an sich wächst. Er weist aber auch<br />
darauf hin, dass mit steigenden Ansprüchen die<br />
Diskussion auch schwieriger wird. In einer Gesellschaft<br />
mit derart hohem internationalen Anteil ist<br />
es schlicht anmaßend von Integration im Sinne von<br />
Assimilation zu sprechen. Die deutsche Gesellschaft<br />
steckt in einem identitären Veränderungsstau.<br />
Wenn dies nicht offen thematisiert wird, bremst sich<br />
Deutschland wirtschaftlich, sozial und politisch<br />
selber aus und desintegriert zu einer hinterwäldlerischen<br />
Angstnation à la Sarrazin, welche die<br />
Schuld ihres Versagens immer auf die Anderen<br />
schiebt.<br />
135<br />
ZUSAMMENFASSUNG